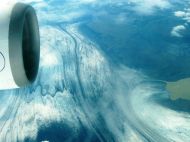Nordwärts nach Oregon
Nur wenige kennen den berühmten „Wilden Westen“ der USA, den Nordwesten. Auf einer Reise von San Franzisco entlang der Küste bis hinauf zum Olympic Nationalpark an der kanadischen Grenze und zurück über den Columbia-River. Durch staubige und heiße Halbwüsten bis hinauf zu den höchsten Gipfeln der „Rockies“ mit seinen Vulkanen, die z. T. noch in jüngster Zeit – Mount St. Helens – gezeigt haben, dass sie längst noch nicht erloschen sind. Eindrucksvolle Küsten, riesige Mammutbäume in den Redwoods oder traumhafte Bergkulissen und endlose Ebenen lassen die beeindruckende Schönheit dieser Region tief im Innern verwurzeln. Einfach gewaltig groß und schön in jeder Hinsicht.
Reisetagebuch durch den wilden Nord-Westen der USA.
Vorbereitung auf die Reise.
Wer das Buch von A. E. Johann „Westwärts nach Oregon – Reise durchs unbekannte Amerika“ gelesen hat, der versteht die Anspielung auf diesen Titel. Es hat mich vor vielen Jahren, als ich leider noch keinen Laptop hatte und somit auch keine Reisetagebücher geschrieben habe, zum ersten Mal in diese Region geführt. Allerdings bin ich damals von Calgary/Kanada in einem großen Bogen gen Süden gefahren. Jetzt möchte ich erneut von der herrlichen Stadt San Franzisco aus, entlang des berühmten Highway No. 1 fahren, die Pazifikküste und die Mammutbäume genießen und dann weiter auf der 101 bis Seattle reisen. Über die Rocky Mountains soll es danach zurück nach San Franzisco gehen. Das ist heute eine bequeme Reise, doch früher – vor ca. 150 Jahren – musste man mühsam über den „Oregon Trail“ mit dem Planwagen reisen; daher wohl auch der Buchtitel von A. E. Johann.
Außer diesem Buch habe ich für meine Reise noch den APA Guide „Pazifischer Nordwesten u.s.a.“ zu Rate gezogen, den ich nur empfehlen kann, da er viel über die Entwicklung aussagt und man vielleicht auch einen kleinen Einblick in die Mentalität seiner Bewohner bekommt. Sehr nützlich fand ich den Baedeker „USA Nordwesten mit Nordkalifornien“, den ich am intensivsten genutzt habe. Den Marco Polo Führer „Kalifornien“ hatte ich zwar dabei, ihn jedoch nicht weiter in Anspruch genommen. Der beinahe wichtigste Begleiter war jedoch der Atlas von Rand MacNally, auf dem man – fast – alle Straßen findet (manche aber auch nicht, wie ich feststellen durfte…).
In der heutigen Zeit ist die Reisevorbereitung durch das Internet fast zu einem Kinderspiel geworden und auch Opas wie ich schaffen das. So habe ich am 10. 8.2009 meine Flüge, meinen Mietwagen und das Hotel für die erste Nacht in San Franzisco für den 20. 8. 09 gebucht. Für Flug und Mietwagen habe ich zusammen 1.104,85 € gezahlt. Das halte ich für günstig.
Über Google Maps habe ich mir meine ungefähre Reiseroute zusammengestellt. Das geht sehr leicht. Man gibt Start und Ziel an und kann dann die Strecke nach eigenen Wünschen per Cursor auf eine beliebige Straße ziehen und schon ist die neue Route fertig. Jetzt ist die geplante Route 2.434 Meilen lang, doch so wie ich mich kenne, wird sie wesentlich länger, weil ich stets dies und das noch besuchen will und somit immer viele Meilen mehr auf dem Tacho habe, wenn ich dann wieder am Airport in San Franzisco angelangt bin. Da ich erst am 8. September zurückfliegen werde, müsste das zu schaffen sein. Es sei denn, ich plane aus Witterungs- oder anderen Gründen die Route um. Daher buche ich auch nie die ganze Tour mit allen Hotelübernachtungen komplett durch, denn dann bin ich nicht mehr flexibel und gezwungen, die gebuchten Tagesziele zu erreichen. Das würde nur Stress bedeuten und ich könnte bei evtl. schlechtem Wetter nicht ausweichen.
Bei meiner Vorbereitung auf diese Reise hat mich die Entstehung der Region interessiert und so habe natürlich im Internet nachgeschaut und dabei nachfolgendes gefunden:
 Die Region zur Eiszeit vor über 15.000 Jahren
Die Region zur Eiszeit vor über 15.000 Jahren
Während der Eiszeit entstand durch einen Eisdamm südlich der heutigen Grenze zu Kanada ein riesiger See, der Lake Missoula. Er wurde durch die Eisschmelze immer größer und glich mit 7.700 Quadratkilometern (halb so groß wie Schleswig-Holstein) und einer Gewässertiefe bis zu 610 Metern (die Ostsee ist nur maximal 460 m tief) einem Binnenmeer. Bis eines Tages vor ca. 15.000 Jahren der Damm brach und sich diese ungeheuren Wassermassen einen Weg zunächst nach Süden und dann nach Westen zum Pazifik suchten. Dabei bahnten sie sich durch die Cascade Range und bildeten die über 80 km lange Columbia Schlucht, durch die heute der Columbia River östlich von Portland fließt. Die Wassermassen ergossen sich in das Williamette Tal und hinterließen dort sehr viele der mitgerissenen Sedimente, was dieses Tal zu einem der fruchtbarsten der Welt gemacht hat. (Quelle: Wikipedia)
Auch interessierte mich, was der „Oregon Trail“ war und wie er verlief. Ohne ihn wäre der „wilde“ Westen – Kalifornien, Oregon, Washington, Idaho, Nevada und Utah – praktisch nicht erschlossen worden. Über eine halbe Million Menschen sind über ihn gen Westen gezogen – mindestens 10 % ließen dabei ihr Leben – um ins fruchtbare Williamette Tal oder nach Kalifornien zum Goldschürfen in den „Goldenen Westen“ zu gelangen. Erst 1869 endete die Bedeutung des Oregon Trails mit der Fertigstellung der Transcontinental Eisenbahn.
Doch zurück zu den Reisevorbereitungen. Zunächst habe ich am Hamburger Flughafen einen Gutschein im Internet für einen um 10 € vergünstigten Parkplatz am Holiday Park beantragt und ausgedruckt. Dann konnte ich 30 Stunden vor der Abflugzeit meinen Sitzplatz und meine Boardingkarte übers Internet buchen, wobei ich zur richtigen Zeit ein Email von Air France bekam, mit der ich geflogen bin. Meine Tochter – die bei der Lufthansa fliegt – meinte zwar, das ich mit der Arline fliege, mit der keiner mehr fliegen will (nach dem Absturz über dem Atlantik), doch das hatte ich schon vergessen und abgehakt. Karma – Schicksal – würde man wohl im asiatischen Raum sagen.
Donnerstag, 20. August 2009
Nachdem ich gestern Abend gegen 22:30 Uhr ins Bett gegangen bin – vorher hatte ich mit meinen Kumpels den Kühlschrank mit Grillwürstchen, Sauerfleisch und Bratkartoffeln leergegessen – habe ich etwas unruhig und mit wilden Träumen die Nacht verbracht, bis dann um 3:00 Uhr (schrecklich!) der Wecker klingelte. Nach meinem obligatorischen Early Morning Tea, der Morgentoilette und einem Müsli, damit der Magen nicht so knurrt, erfolgte ein letzter Check, ob ich auch nichts vergessen habe (kann schon mal passieren…), saß ich dann um 10 nach 4 im Auto, um rechtzeitig am Hamburger Flughafen zu sein.
Es ist schon erstaunlich, wie viele Autos um diese nachtschlafende Zeit bereits unterwegs sind, und sie wollen bestimmt nicht alle zum Flughafen nach Hamburg, um über Paris nach San Franzisco zu fliegen…
Gegen kurz vor 5 Uhr kam die erste Morgendämmerung auf. Da merkt man, dass schon wieder zwei Monate nach der Sommersonnenwende vergangen sind, denn um den 21. Juni herum scheint die Sonne schon vor 4 Uhr in der Früh.
Am Flughafen lief alles reibungslos ab. Zwar brauchte ich ein paar Minuten, um auf dem stets sehr vollen Holiday Parkplatz eine Lücke für meinen Wagen zu finden, doch als dies geschehen war, kam auch gerade der Shuttlebus und brachte mich zum Terminal. Dort war ich einer der ersten und weil ich schon übers Internet eingecheckt hatte, brauchte ich nur noch mein Gepäck aufgeben. Die Countermitarbeiterin schwatze mir zwar noch einen Antrag auf Vielfliegermitgliedschaft auf, weil sie meinte, dieser Flug würde viele Freimeilen erbringen. Nun gut, überredet. Mit meiner zittrigen Morgenhand (es wird immer schlimmer) füllte ich den Antrag aus (hoffentlich können die meine Krickelbuchstaben auch lesen) brachte mein Golfgepäck zum Sperrgut-Schalter und nun sitze ich am Gate C 07, warte auf meinen Abflug nach Paris und schreibe diese Zeilen. Es ist inzwischen 6:15 Uhr und unser Flieger steht schon am Gate. Noch etwa eine halbe Stunde und ich dürfte wohl im Flugzeug sitzen.
 Links steht schon unser Flieger und wartet auf uns.
Links steht schon unser Flieger und wartet auf uns.
Der Flug nach Paris war kurz und der Aufenthalt am Flughafen Orly war eigentlich langweilig, wie alle Zwischenstopps auf Flughäfen (finde ich). Die neue Flughafenhalle in Orly – übrigens die, die kurz vor der Eröffnung in sich zusammengesackt war.
Doch zum Glück dauerte der Aufenthalt nicht allzu lange und so saß ich denn schon bald im Flieger an einem schönen Fensterplatz und konnte daher während des Fluges alles von oben betrachten.
Doch zurück zum gestrigen Tag. Der Flieger in Paris flog etwa eine Stunde später ab, als eigentlich geplant. Da kommt man schon etwas ins Grübeln, ob vielleicht mal wieder was mit der Maschine nicht ganz in Ordnung war. Es lag wohl auch daran, dass auf der Piste schon eine ganze Menge wartender Maschinen standen, so dass es über 15 Minuten gedauert hat, bis wir aus dem Stau herauskamen.
 “Stau“ am Flughafen Charles de Gaulles
“Stau“ am Flughafen Charles de Gaulles
Über Paris war es sehr dunstig – und mit 33 ° auch sehr warm – so dass man noch nicht einmal den Eiffelturm erkennen konnte als wir abflogen. Dann verdichtete sich der Himmel immer mehr und man sah kaum noch etwas vom Land. Erst über dem Ärmelkanal riss die Bewölkung etwas auf, so dass ich nur hin und wieder mal ein Schiff sehen konnte. Dann zog es wieder zu und ich dachte nur, „über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein“, wie Reinhard May so schön gedichtet hat. Sie (die Freiheit) ist allerdings nur draußen, drinnen ist es sehr eng! Zum Glück ging eine in meiner Reihe sitzende Frau in eine andere Sitzreihe, in der wohl noch ein Plätzchen frei war, denn sonst hätten wir zu dritt in der 3er-Reihe gesessen! Na ja, was will man mehr, wenn man sich den billigsten Flug ausgesucht hat? So blieb zumindest der Mittelplatz leer, was dann ja auch ganz angenehm war.
Zum ersten Mal bin ich wohl direkt über Island geflogen und konnte – da der Himmel wieder aufriss – aus der Luft die wahnsinnigen Gletscherströme beobachten:
Das war schon das erste imposante Erlebnis aus der Luft, denn auf Islandbildern sieht man ja immer nur Gletscher, die von der Erde aus aufgenommen worden sind und die somit die riesigen Dimensionen gar nicht wiederspiegeln können.
Die nächsten Gletscher – und Eisberge – ließen nicht lange auf sich warten: Grönland.
 Grönlands Eisberge und Gletscher auf der Ost – und Westseite
Grönlands Eisberge und Gletscher auf der Ost – und Westseite
Welches Wetterglück ich hatte, bemerkte ich erst kurze Zeit später, denn nach diesen Bildern zog sich der Himmel wieder zu und man sah nur Reinhard Mays Freiheit über den Wolken. Bis wir dann über Amerika angelangt waren.
 Leider habe ich nicht nachverfolgen können, über welche Regionen wir geflogen sind, da die Flugroute nur zu Beginn und am Ende des Fluges auf den Monitoren gezeigt wurde. Während des Fluges wusste man dann nicht mehr, wo man gerade war, denn es liefen mehrere Filme, die ich mir jedoch nicht angeschaut habe, denn französisch kann ich sowieso nicht verstehen und in Englisch ist mir das immer alles zu schnell gesprochen und der Lärm im Flugzeug ist auch zu laut, so dass ich immer nur die Hälfte mitbekomme. Das macht dann auch keinen Spaß. Meine gute Landkarte von Rand McNally hatte ich leider im aufgegeben Gepäck verpackt und liegt somit in meinem dicken Koffer irgendwo im Bauch des Jumbos. Ich dachte zwar, dass man die Bilder später vielleicht irgendwie zuordnen könnte – an der Form des Gebirges oder eines typischen Sees – doch das ist mir nicht gelungen.
Leider habe ich nicht nachverfolgen können, über welche Regionen wir geflogen sind, da die Flugroute nur zu Beginn und am Ende des Fluges auf den Monitoren gezeigt wurde. Während des Fluges wusste man dann nicht mehr, wo man gerade war, denn es liefen mehrere Filme, die ich mir jedoch nicht angeschaut habe, denn französisch kann ich sowieso nicht verstehen und in Englisch ist mir das immer alles zu schnell gesprochen und der Lärm im Flugzeug ist auch zu laut, so dass ich immer nur die Hälfte mitbekomme. Das macht dann auch keinen Spaß. Meine gute Landkarte von Rand McNally hatte ich leider im aufgegeben Gepäck verpackt und liegt somit in meinem dicken Koffer irgendwo im Bauch des Jumbos. Ich dachte zwar, dass man die Bilder später vielleicht irgendwie zuordnen könnte – an der Form des Gebirges oder eines typischen Sees – doch das ist mir nicht gelungen.
Wie dem auch sei, es ist einfach faszinierend für mich, über die zerklüfteten Landschaften Nordamerikas zu fliegen – dem „Wilden Westen“ – und sich dabei Gedanken darüber zu machen, ob ich diese Landschaften auf der Rundreise am Boden auch sehen und dann wiedererkennen werde.
Fragen über Fragen, die mir auf dieser Reise wohl kaum einer – auch ich nicht – beantworten kann. Nächstes Mal nehme ich den Atlas mit ins Handgepäck!
Wir näherten uns dem Ende des Fluges. Und was ist das?
Das ist ja das Besondere an San Franzisco, dass der Seenebel praktisch nur durch die Golden Gate Lücke hindurch kommt, da die Berge nördlich und südlich zu hoch sind, so dass er nicht hinüber kann. Also kriecht er durch den Sund und verhüllt somit die halbe Stadt im Nebel. Südlich davon war alles wieder klar, so dass wir auch ohne Probleme im klarsten Sonnenschein landen konnten.
Schlimm ist es auf großen Flughäfen in den USA mit den Zollformalitäten – außer vielleicht in Anchorage/Alska, wo ich vor zwei Jahren war. Man wartet und wartet in unendlich langen Schlangen. Ich glaube, die Amerikaner haben die berühmten Absperrketten erfunden, bei denen man erst durch zahlreiche Parallelschlangen gehen muss, bevor man endlich zum Abfertigungsschalter kommt. Dort wird man höflich gebeten, sich die Finger beider Hände einscannen zu lassen, als wäre man ein Verbrecher. Man darf die Brille abnehmen, damit der „Inspector“ ein schönes Foto für das Poesiealbum des Heimatministers machen kann. Dann wird man gefragt – das war auch schon vor 9/11 der Fall – , was man denn in den USA machen will, als ob die Behörden wirklich nachprüfen würden, ob man wirklich das macht, was man angibt oder nicht.
Besonders witzig finde ich die Fragen auf dem Einwanderungsformular: Ob man Waffen oder Rauschgift dabei hat, Menschen umbringen will oder Anhänger von Al Quaida ist und weitere so nette Fragen. Wenn man alle Fragen bei „Yes“ ankreuzen würde – wie es so herrlich der Schwiegervater von Jan Weiler in dem Buch „Antonio im Wunderland“ getan hat, dann landet man natürlich sofort in Handschellen im Verhörraum. Welcher Verbrecher, der wirklich diese Fragen in die Tat umsetzen wollte, würde wohl so dumm sein, sie mit „Yes“ zu beantworten? Den würde ich nicht in den Knast sondern ins Irrenhaus sperren. Wer sich diese Fragen – über die ich mich schon immer amüsiert habe, wenn ich in die USA geflogen bin – wohl ausgedacht und beschlossen hat?
Ich hatte sogar noch das Glück, einen sehr netten Beamten zu erwischen, der mein Einwanderungsformular eigenhändig verbessert und mich nicht zurückgeschickt hat, um einen neuen richtig auszufüllen (was durchaus passieren kann). Mein Fragebogen, den ich in Paris am Abflugschalter mitgenommen hatte, war ja auch nur in Französisch gewesen und ich hatte statt meiner Adresse in San Franzisco meine Heimatadresse angegeben.
Nachdem ich diese Prozedur überstanden hatte, bin ich dann auf die Suche nach den Rent-a-car-Countern gegangen. Nun, ich war schon länger nicht auf einem großen Flughafen in den USA, denn meistens sind diese Counter in der Ankunftshalle zu finden. Nicht hier. Man muss erst mal mit einem Lift in den 4. Stock fahren – zum Glück kann man seinen Gepäckwagen mitnehmen und braucht nicht alles zu schleppen – und fährt dann mit einem Shuttlezug mehrere Stationen zur Endstation, wo die Autovermieter zu finden sind.
Alles geht automatisch in diesem Shuttlezug zur Mietwagenstation. Führerloser Shuttlezug am Flughafen
Führerloser Shuttlezug am Flughafen
Na ja, auch da wartet man dann mindestens 20 Minuten erneut in einer dieser amerikanischen Warteschlangen, bis man endlich dran ist und seine Papiere bekommt. Neu für mich war auch, dass auf diesem Mietvertrag nicht das Autokennzeichen drauf war, sondern der Mitarbeiter schrieb einfach auf den Umschlag „Compact“, weil ich mir ja keinen großen Straßenkreuzer – oder modern: SUV – gemietet hatte, sondern nur die kleinste Kategorie (was brauch ich als Einzelperson mehr?). Nur wenige Schritte weiter war man dann auch schon an der Übergabestation, wo eine nette Dame sich meinen Umschlag ansah und meinte, dass im Augenblick kein Compact-Car vorhanden war.
Die Autos standen auch nicht in einer langen Reihe, wie ich das so kannte, sondern wurden einzeln von Mitarbeitern herangefahren. Langsam bildete sich auch hier wieder ein Bündel von wartenden Automietern – allerdings völlig ungeordnet und nicht in einer amerikanischen Schlange – so dass ich weiterhin wartete. Es kam und kam kein Compact-Car und so wartete ich weiter. Doch dann die große Überraschung: der netten Dame wurde es wohl auch zu viel und sie schickte mich zu einem bereits seit geraumer Zeit dastehenden Auto. Viertürige Mittelklasse, die bestimmt für vier Personen mit Gepäck ausgereicht hätte! Sie hatte mir auch keinen Schlüssel gegeben – der steckte in der Autotür – und auf meinen Papieren wurde auch nicht die Autonummer und Marke eingetragen. Dieses System habe ich bis jetzt noch nicht kapiert. Aber ich habe nun ein sehr komodiges Auto – übrigen ein Hyundai Sonata – bekommen, mit dem ich jetzt losfahren kann.
 Natürlich hat San Francisco ein ausgeklügeltes Straßennetz und an Kreuzungen geht es manchmal 4- bis 5-stöckig übereinander. Zum Glück hatte ich am Auscheck-Schalter der Mietwagenstation – die mit spitzen Stahlspießen im Boden davor gesichert ist, dass ein Mietwagenfahrer, der diese Station vielleicht ignorieren möchte und einfach weiterfährt – den Mitarbeiter gefragt, ob das „Traveloge Airport Hotel“ nördlich oder südlich zu finden ist. Er sagte mir, ich müsste südlich fahren und das tat ich denn auch. Doch die Straße führte zunächst nördlich, so dass ich mich schon wunderte. Doch dann kam ein Hinweisschild, dass die Zufahrt zur 101 South rechts abführt und dem Hinweis folgte ich dann auch. So kam ich auf die 101 South. Auf die Schnelle hatte ich meine sorgfältig geordneten Reiseunterlagen noch in meiner Tasche mit dem Laptop gelassen und die lag im Kofferraum. Also an der nächst besten Möglichkeit auf einen breiten Seitenstreifen fahren, um mir die genaue Anschrift des Hotels herauszusuchen und auf der Karte nachzuschauen, wo das denn sein könnte. El Camino Real – Ecke Millbrae Ave. Nun, das schien mir einfach zu sein, also fuhr ich weiter. Da war auch schon nach wenigen Minuten die Ausfahrt Millbrae und ich ordnete mich rechts ein.
Natürlich hat San Francisco ein ausgeklügeltes Straßennetz und an Kreuzungen geht es manchmal 4- bis 5-stöckig übereinander. Zum Glück hatte ich am Auscheck-Schalter der Mietwagenstation – die mit spitzen Stahlspießen im Boden davor gesichert ist, dass ein Mietwagenfahrer, der diese Station vielleicht ignorieren möchte und einfach weiterfährt – den Mitarbeiter gefragt, ob das „Traveloge Airport Hotel“ nördlich oder südlich zu finden ist. Er sagte mir, ich müsste südlich fahren und das tat ich denn auch. Doch die Straße führte zunächst nördlich, so dass ich mich schon wunderte. Doch dann kam ein Hinweisschild, dass die Zufahrt zur 101 South rechts abführt und dem Hinweis folgte ich dann auch. So kam ich auf die 101 South. Auf die Schnelle hatte ich meine sorgfältig geordneten Reiseunterlagen noch in meiner Tasche mit dem Laptop gelassen und die lag im Kofferraum. Also an der nächst besten Möglichkeit auf einen breiten Seitenstreifen fahren, um mir die genaue Anschrift des Hotels herauszusuchen und auf der Karte nachzuschauen, wo das denn sein könnte. El Camino Real – Ecke Millbrae Ave. Nun, das schien mir einfach zu sein, also fuhr ich weiter. Da war auch schon nach wenigen Minuten die Ausfahrt Millbrae und ich ordnete mich rechts ein.
Soweit so gut, doch dann musste ich mich entscheiden, ob West oder East und da ich nach Westen abgebogen war und ich nach South musste, konnte es nach meiner Logik nur „East“ sein, wo ich abbiegen müsste. Also gedacht – getan. Doch das war falsch! Diese Straße führte mich direkt zurück zum Flughafen! „Toll“ dachte ich mir, doch das nahm ich ganz locker und amüsierte mich über meine Orientierungsfähigkeiten. Also zurück um Flughafen und die ganze Prozedur noch einmal. Doch diesmal hatte ich wieder eine brillante Idee, denn es gab auch ein Hinweisschild West nach San Bruno und dazwischen musste die El Camino Real liegen. Und sehe da, ich lag bzw. fuhr richtig! Es war zwar noch ein ziemliches Stück bis zur Millbrae Avenue, da es unzählige Ampeln gibt, doch was macht das schon. Endlich kam die Avenue und ich sah auf der anderen Seite auch schon das Tavelodge. Links einordnen, an der Ampel einen – erlaubten – U-Turn machen und dann zum Hotel.
Doch wie das Schicksal es so will: es gibt keine direkte Einfahrt von der El Camino Real zum Hotel, sondern nur von einer kleinen Parallelstraße, die man an der Ampel normalerweise nicht so richtig im Kalkül hat. Und so landete ich wieder auf der Millbrae Ave., die mich über eine Eisenbahnbrücke und wieder zurück zur 101 führte. Das wollte ich natürlich nicht und bog nach links ab – hier war kein U-Turn möglich – und landete in einer Zufahrt zu einem Firmengelände. Da machte ich dann erneut einen U-Turn und kam wieder auf die Millbrae Avenue. Bog wieder nach links ab, dann wieder nach links und diesmal in die kleine Parallelstraße. Ein netter Fahrer vom Gegenverkehr hielt sogar an und gab mir ein Handzeichen, das ich vorfahren durfte (ihm war das Problem zum Hotel zu kommen offenbar bekannt) und so gelangte ich dann auch in die richtige Straße und auf den Parkplatz des Hotels. Tja, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben!
Das Travelodge ist ein nettes Hotel mit netten Empfangsdamen. Die eine war schon in mehreren Städten in Deutschland gewesen unter anderem in Rothenburg o. d. T. und fand es wäre ein Fairytale-Städtchen, womit sie recht hat.
Das Zimmer war typisch für solche Hotels oder Motels in den USA, doch überraschten mich nette Details wie Safe, Coffemaking Facilities (allerdings ohne Tee) und Bügelbrett mit Bügeleisen. Habe ich gleich fotografiert und mir für meine geplanten Container-Hotels gemerkt.
Die Dusche könnte mal wieder gestrichen werden, weil sich an der Decke die Farbe vom Wasserdampf langsam löst, doch sonst war alles Tipptop. Die berühmten Queensize-beds und ein kleiner Schreibtisch, an dem ich jetzt sitze und schreibe.
Da ich keine Lust hatte, täglich meinen schweren Koffer aufs Zimmer zu schleppen, wollte ich mir eine kleine Reisetasche besorgen, in die ich dann meine jeweilige Nachtutensilien und Wäsche für eine Übernachtung packen würde. Beim Heruntergehen kam ich auf der 2. Etage an sechs Herren vorbei, die sich auf dem Gang gerade ein kühles Bier genehmigten. Einer sprach mich an, ob ich nicht auch ein Bier möchte, was ich dankend ablehnte (bin ja kein Säufer!). Als ich danach mit einem nahezu erfolgreichen Einkauf (die Reisetasche in hellblau würde ich mal als Kinderrucksack bezeichnen) zurück kam, führte mein Weg in den dritten Stock erneut an den Herren vorbei und sie boten mir erneut ein Bierchen an. Also sagte ich o. k. (Zweimal nein sagen ist wohl doch unhöflich, oder?)
Es stellte sich schnell heraus, dass es Holländer waren, die auch gerade erst angekommen waren und sich Harley Davidson Motorräder gemietet hatten, mit denen sie 14 Tage lang den Westen erkunden wollten. Das fand ich schon Klasse! Ich bin zwar kein Motorradfan, da mir das Risiko doch zu groß erscheint. Doch auf einer Harley durch die USA zu reisen, wo man ja eh nicht mehr als 55 Meilen pro Stunde fahren darf, hat schon was für sich. Sie kamen aus Assen – bekannt durch seine Rennstrecke – und als ich ihnen sagte, dass ich in Oldenburg ein Hotel habe, wollten sie meine Visitenkarte vom Hotel haben, die ich selbstverständlich gerne gab (man muss ja was fürs Geschäft tun!). Sie waren übrigens mit British Airways geflogen und hatten ca. 200 € mehr für das Ticket bezahlt als ich!
Da ich noch etwas essen wollte, fragte ich an der Rezeption, die man hier „Office“ nennt, ob der kleine Italiener, den ich gegenüber dem Supermarkt gesehen hatte, gut wäre, was bejaht wurde. Also ging ich erneut über die 6-spurige Straße auf die andere Seite und bestellte mir ein Hot Sandwich mit Chicken und Tomate und ein Glas Rotwein. Sollte 16 Dollar und etwas kosten. Ich hatte allerdings nur 16 Dollar in bar und einen Hundertdollarschein, den er allerdings nicht wechseln wollte. Er meinte, ich könnte in ja nebenan in der Bank tauschen, was ich dann auch versuchte. O, die war schon dicht, denn es war kurz nach 6 Uhr abends. Also zurück zum Italiener und dort bezahlte ich nur mein Sandwich. Für das kleine Gläschen Wein (es war höchsten 0,1 l) wollte man 7,50 $ haben(!), so dass ich froh war, mir vorher im Supermarkt eine Flasche Wein für 1,99 $ gekauft zu haben. Daher ging ich danach noch einmal zum Supermarkt und kaufte drei weitere Flaschen Shiraz, um mich bei den Holländern mit einem Schoppen Rotwein revanchieren zu können. Doch daraus wurde leider nichts, denn sie waren nicht mehr da. Schade. So habe ich nun vier Flaschen für die Reise…
Ich verzehrte mein Sandwich zusammen mit dem sehr günstigen Shiraz und begann mein mitgebrachtes Buch „Adams Pech, die Welt zu retten“ von Arto Paasilinna. Ich glaube, ich bin so gegen 8 ins Bett gegangen, denn da fielen mir wirklich die Augen zu.
Freitag, 21. August 09
Wann wurde ich heute Morgen zum 1. Mal wach? Ich glaube es war gegen 4 Uhr früh. Na ja, um 13:00 Uhr deutscher Zeit sollte man auch langsam aufstehen und sich an den PC setzen, um zu schreiben, was gestern denn so passiert ist.
Ich wollte gerade anfangen, da besann ich mich darauf, dass es wohl besser wäre, den Atlas aus dem Auto zu holen, um auch zu wissen, wo man nun genau war. Gesagt getan. Ich zog mir kurz meine Hose über, nahm die Zimmerkarte und den Autoschlüssel mit und holte den Atlas aus dem Auto. Als ich danach die Zimmertür öffnen wollte, klappte es nicht – auch nach mehrmaligen Versuchen. Oh Graus! Und das mitten in der Nacht. Zum Glück hatte ich gesehen, dass im „Office“ ein Nachtportier saß und so ging ich wieder runter und erzählte ihm, dass die Tür sich nicht öffnen ließ. Er programmierte mir eine neue Karte und ich ging wieder in die dritte Etage. Klappte wieder nicht, auch nach erneut mehrmaligen Versuchen. Wieder runter und wieder mein Malheur berichten. Da zog er sich die Schuhe an, nahm eine neue Karte mit, auf die er wohl einen Mastercode programmierte, holte sich seine Taschenlampe und kam mit auf die dritte Etage. Er nahm meine Karte und probiert sie: es funktionierte! Zahnarzt-Effekt dachte ich und er wohl Ähnliches – wenn es so etwas in den USA gibt. Vielleicht hat er sich aber auch ganz was anderes gedacht, so im Sinne von „bisschen doof, der Alte, oder?“ Na ja, es war mir auch egal. Ich bedankte mich vielmals und war froh, wieder im Zimmer zu sein, denn es war draußen ganz schön frisch.
Also begann ich zu schreiben. All das, was vorher geschehen war und zum 20. August gehörte, habe ich dann geschrieben und danach hatte meinen gestrigen Tag „im Kasten“, wie man beim Film sagen würde.
Doch nun zum heutigen Tag. Es ist inzwischen schon 6:25 Uhr und da es ab 6:00 Uhr Frühstück gibt, will ich mir jetzt erst mal was in den Bauch tun, zumal ich mir ja auch keinen Early Morning Tea machen konnte. Jetzt ist es auch schon hell geworden, obgleich die Sonne noch nicht aufgegangen ist. Hier wird es also später hell als in Deutschland.
Es war nicht nur die Morgendämmerung, die ich so gegen 6 Uhr gesehen hatte, es war auch nebelig, so dass ich nicht sagen kann, wann die Sonne in California morgens aufgeht. Als ich später gegen 9 Uhr beim Auschecken den netten und hilfsbereiten Nachtportier fragte, wann der Nebel sich lichten würde, war er ganz zuversichtlich und meinte, dass es wohl nur noch eine halbe Stunde dauern würde, bis die Sonne den Nebel wegbrennt.
Denkste! Es war fast den ganzen Tag über nebelig an der Küste! So habe ich vielleicht auch eine falsche Entscheidung getroffen, denn – flexibel wie ich bin – überlegte ich, ob ich erst in den Yosemite Nationalpark fahren sollte und auf dem Rückweg entlang der Küste, oder meinen ursprünglichen Plan: erst die Küste und dann die Rockies. Doch ich vertraute seiner Wetterprognose oder seiner Erfahrung und blieb bei meinem alten Plan.
So fuhr ich auf die 101 North und kann direkt nach San Francisco ins Zentrum. Da es immer noch neblig war, folgte ich dem Schild zum Fisherman´s Warf und kam damit auch an den filmbekannten Straßen vorbei und durchfuhr sie.
Die berühmten steilen Straßen von San Francisco.
Das „Cable Car“ darf natürlich auch nicht fehlen… …und ein Blick auf Alcatraz ebenso wenig!
…und ein Blick auf Alcatraz ebenso wenig! Alcatraz
Alcatraz
Fisherman´s Warf ist heute nur eine einzige Vergnügungsmeile – wenn eine Meile ausreicht – voller Hotels, Restaurants und Parkhäuser. Da hat es mich nicht gereizt anzuhalten und somit bin also nur durchgefahren. Vor etlichen Jahren war ich schon mal dort gewesen, da hatte es mir viel besser gefallen.
Ich hätte mir natürlich auch noch die Zeit nehmen können, das „Archbishops Manison“ zu suchen, das einmal ein Romantik Hotel war. Ich habe nicht gesucht, wohl auch, weil mein vergessliches Gehirn nicht mehr in der Lage war, sich an den Namen der beiden Inhaber zu erinnern. Sonst hätte ich es wohl getan. Meine Tochter Nina hatte mir zumindest noch den Namen des Hotels genannt, den hatte ich nämlich auch schon vergessen. Ja, man lässt halt nach, doch das liegt offensichtlich in der Familie (wenn auch nicht bei allen Mitgliedern…).
Leider haben meine Nachfolger alle amerikanischen Romantik Hotels rausgeschmissen, weil sie so kurzsichtig waren, nicht zu erkennen, welch ein wertvolles Marketing-Instrument Romantik Hotels in dem wohl wichtigsten touristischen Markt der Welt sind.
So fuhr ich denn auf die Golden Gate Bridge. Und hier sieht man sie (etwas verschwommen):
 Ich bin weder besoffen gewesen noch war meine Linse von der Kamera benebelt: es war die Brücke selbst, die sich eingenebelt hatte!
Ich bin weder besoffen gewesen noch war meine Linse von der Kamera benebelt: es war die Brücke selbst, die sich eingenebelt hatte!
Die „Golden Gate“-Brücke hüllt sich mal wieder vor lauter Scham in ein Wolkenkleid, damit man sie nicht gleich erkennen kann. Typisch Weib oder besser: Sie möchte nicht sofort in ihrer ganzen Schönheit erkannt werden und lässt die Besucher etwas zappeln. Das ist typisch für S.F. (Abkürzung von Kennern für San Francisco): Der Nebel gehört zu S.F. wie die Butter zum Brot (so hat das bestimmt noch keiner beschrieben!).
Möchten Sie sie noch einmal von der Nordseite sehen? Selbstverständlich! Sehen Sie, hier ist sie: Wo ist die Golden Gate Bridge?
Wo ist die Golden Gate Bridge?
Nachdem ich nun die benebelte Golden Gate Bridge verlassen hatte, wollte ich kurz durch Sausalito fahren, doch gelangte ich statt ans Ufer, wo ich schöne Häuser in Erinnerung hatte, in einem privaten Yachthafen, und musste somit umkehren. Dann ging´s auf die „Schönste Traumstraße der Welt“ wie die Werbung verspricht: Den Pacific Coast Highway No 1. Wer diesen Spruch erfunden hat, war wohl noch nicht weit herumgekommen.
Auch Traumstraßen sind im Nebel nicht so attraktiv, weil man nichts sieht und so fuhr ich zunächst durch die nebeligen Muir-Berge bis Muir Beach. Direkt an der Abzweigung zum Strand denkt man, man wäre in England. Da steht das „Pelikan Inn“, eine getreue Kopie eines typischen englischen Country Inns. Ich fragte an der Rezeption und siehe da: Ja, es ist nachgebaut und fast die gesamte Inneneinrichtung ist aus England importiert worden. Zimmer konnte ich mir nur auf Fotos ansehen – die anderen wären noch belegt, was ich nicht glauben konnte, denn so viele Autos standen nicht auf dem Parkplatz. Doch was soll´s. Die Preise waren sowieso nicht meinem Reisebudget entsprechend und das hat der Mann an der Rezeption wohl gespürt.
Der Strand war eher langweilig und voller Hunde – ein Mann brachte sechs (!) seiner „Rassehunde“ unterschiedlichster Mischung mit, von denen einer mich gleich abschlabberte. Ich versuchte, seinen Speichel mit Sand abzureiben, denn wer weiß, was für Hunde-, Schweine- oder Vogelgrippe-Viren sich darin befanden.
 Beim Weiterfahren sah ich mehrere weiße Felsen. Es sind keine Kalk- sondern eher „Kack“-Felsen! Sie sind vom Kot der Seevögel, die sich auf ihnen niedergelassen haben, so weiß!
Beim Weiterfahren sah ich mehrere weiße Felsen. Es sind keine Kalk- sondern eher „Kack“-Felsen! Sie sind vom Kot der Seevögel, die sich auf ihnen niedergelassen haben, so weiß!
Hinter dem kleinen Dörfchen Dogtown (hat nur 30 Einwohner und nennt sich schon Stadt!) rissen die Nebelschwaden auf und der strahlend blaue Himmel kam zum Vorschein. Das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn man die Landschaft im Nebel und dann in prachtvoller Sonne erlebt.
Die Route No. 1 ist schon eine schöne Strecke, die ich nun schon zum dritten oder vierten Mal erlebte und immer wieder gerne befahre. Da sie nicht nur an der Küste entlang führt, sondern auch Abstecher ins Land macht, bekommt man nicht nur Meer und Küste zu sehen, sondern auch sehr schöne Landschaften, wobei ich diese grasbewachsenen Berge gerne als „Golden Hills“ bezeichne, obgleich sie sicherlich ganz anders heißen.
 Hier möchte man wohnen, doch das Haus stand leer (bestimmt nicht durch die Finanzkrise)
Hier möchte man wohnen, doch das Haus stand leer (bestimmt nicht durch die Finanzkrise)
In einem kleinen Dorf machte ich Halt, um nicht nur das historische Hotel zu fotografieren (einmal Romantiker – immer Romantiker!), sondern um auch etwas Obst und ein köstliches Stangenbrot zu erwerben.
Doch im nächsten Ort – Tomales – erlebte ich eine richtige Überraschung: Sowas hätte ich mir im Leben nicht träumen lassen, dass ich einen General Store in California habe!
 Ich bin natürlich rein und fragte, ob die Eigentümer tatsächlich noch Diekmann heißen. Und siehe da, die Inhaberin Kristin Lawson ist eine geborene Diekmann! Wir versuchten herauszufinden, woher ihre Familie stammte und sie meinte, einen Ort wie Wenthagen in Erinnerung zu haben. Der Ort sagte mir zwar nichts, doch das kann man ja im Internet recherchieren, was ich auch machen werde. Muss doch herauszubekommen sein! (Habe ich auch. Das ist ein Dorf in der Nähe von Steinhagen bei Hannover und dort habe ich nach der Rückkehr sogar noch ein Grab gefunden! Weitere Recherchen führten allerdings ins Leere.)
Ich bin natürlich rein und fragte, ob die Eigentümer tatsächlich noch Diekmann heißen. Und siehe da, die Inhaberin Kristin Lawson ist eine geborene Diekmann! Wir versuchten herauszufinden, woher ihre Familie stammte und sie meinte, einen Ort wie Wenthagen in Erinnerung zu haben. Der Ort sagte mir zwar nichts, doch das kann man ja im Internet recherchieren, was ich auch machen werde. Muss doch herauszubekommen sein! (Habe ich auch. Das ist ein Dorf in der Nähe von Steinhagen bei Hannover und dort habe ich nach der Rückkehr sogar noch ein Grab gefunden! Weitere Recherchen führten allerdings ins Leere.)
Auf jeden Fall musste ich in „meinem“ Laden etwas kaufen und nahm eine Flasche Icetea aus dem Kühlschrank und dann sah ich ein Baseball-Cap mit „Diekmann`s“ darauf. Diese musste ich natürlich haben!
Früher hatte ich in meiner Heimatgemeinde schon mal alte Kirchenbücher gewälzt, um meine Ahnentafel zu recherchieren und so dachte ich mir, frage doch mal in der örtlichen Kirche nach, ob dort vielleicht etwas über die Diekmann Familie zu finden ist. Das örtliche Heimatmuseum hatte leider geschlossen.
 The Church of Assumption in Tomales
The Church of Assumption in Tomales
Ich besuchte also die schöne Kirche, um herauszufinden, ob dort in den Kirchenbüchern etwas zu finden wäre. Der nette Priester – später habe ich im Internet herausgefunden, dass er Robert K. White heißt – meinte allerdings gleich, dies wäre ja eine katholische Kirche und da würde man wohl nichts finden, denn die Diekmann´s waren ja protestantisch. Ich sollte doch mal versuchen, in der sieben Meilen entfernten Presbyterianischen Kirche nachzufragen. Er suchte zwar noch in einem alten Buch nach dem Namen, fand jedoch nur eine Familie ähnlichen Namens. Also fuhr ich die 7 Meilen und fand die Kirche auch sofort an der Kreuzung zum Highway 116.
Doch die Pastorin Rev. Dr. Cornelia Cyss Crocker (da kommt Respekt auf!) war nicht anwesend und alles war verschlossen. Schade. Ich versuchte noch, auf dem alten, verfallenen Kirchhof einen Grabstein mit dem Namen Diekmann zu finden, doch das war auch ergebnislos. Sie sind wohl irgendwo anders begraben worden. „Ihre Spuren verloren sich im Nichts“ würde ein Schriftsteller jetzt wohl schreiben. Schade, denn wenn ich herausbekommen hätte, woher die Diekmanns gekommen sind, wäre das ein wirkliches Erlebnis geworden.
Im Internet habe ich dann abends unter Wendthagen gesucht und einen Ort bei Stadthagen in Niedersachsen gefunden. Als ich dann den Namen Diekmann eingab, kam als Ergebnis ein Füselier H. Diekmann, der 1870 gefallen ist. Also kann es durchaus sein, dass die Vorfahren aus dem Ort Wendthagen gekommen sind. Das werde ich der Frau Lawson wohl mal schreiben, wenn ich wieder zuhause bin (Was ich auch getan habe).
Zurück zur Küste kommt man an die Bodega Bay und sieht schon wieder den Seenebel in der Ferne.
 An der Bodega Bay lebt man vom Fischfang.
An der Bodega Bay lebt man vom Fischfang.
 Auch er lebt vom Fischfang
Auch er lebt vom Fischfang  Ob das ein Knochen eines Wales war, oder ein verknöcherter Anker habe ich nicht erkennen können.
Ob das ein Knochen eines Wales war, oder ein verknöcherter Anker habe ich nicht erkennen können.

 Und hier denkt man an Hitchcocks Film „Die Vögel“, der hier in der Nähe auch gedreht worden ist.
Und hier denkt man an Hitchcocks Film „Die Vögel“, der hier in der Nähe auch gedreht worden ist.
Von der Bodega Bay aus lohnt sich auf jeden Fall ein Abstecher über die Colman Road nach Occidental, denn nicht nur der Blick zurück zum nebligen Pazifik ist sehr reizvoll, sondern eigentlich die ganze Strecke.
 Herrliche Ausblicke zurück zur nebeligen Küste
Herrliche Ausblicke zurück zur nebeligen Küste

 Immer wieder diese herrlichen Blumen
Immer wieder diese herrlichen Blumen  und tollen Landschaften
und tollen Landschaften  Occidental
Occidental

 Der Russian River führt zurück an den Pazifik nach Jenner…
Der Russian River führt zurück an den Pazifik nach Jenner…
 …wo der Nebel immer noch in Schwaden herumhing. Auf der Weiterfahrt entlang der Traumstraße habe ich immer wieder die phantastischen Ausblicke aufs Meer genossen, bis ich dann – langsam müde vom vielen Fahren und Sehen – in Gualala angekommen bin.
…wo der Nebel immer noch in Schwaden herumhing. Auf der Weiterfahrt entlang der Traumstraße habe ich immer wieder die phantastischen Ausblicke aufs Meer genossen, bis ich dann – langsam müde vom vielen Fahren und Sehen – in Gualala angekommen bin.
 Hier habe ich mal wieder lernen müssen, dass man sich in manchen Gegenden an Preise gewöhnen muss, die man nicht für möglich hält. So habe ich in dem kleinen „Gualala Country Inn“ gewohnt, wo das Zimmer incl. Tax über 160 $ gekostet hat. Im Preis war ein klitzekleines Frühstück enthalten. Der Inhaber – war es wohl – führt das Inn ganz alleine und hat höchstens ein paar Zimmermädchen beschäftigt. Wenn Gualala ein toller Ort gewesen wäre, hätte man ja vielleicht noch sagen können, dass man einen Ortszuschlag rechnen muss, wie ich es in Mendocino erwarten würde, doch was bietet schon Gualala? Höchstens Aufregung, wie ich gleich erfahren durfte:
Hier habe ich mal wieder lernen müssen, dass man sich in manchen Gegenden an Preise gewöhnen muss, die man nicht für möglich hält. So habe ich in dem kleinen „Gualala Country Inn“ gewohnt, wo das Zimmer incl. Tax über 160 $ gekostet hat. Im Preis war ein klitzekleines Frühstück enthalten. Der Inhaber – war es wohl – führt das Inn ganz alleine und hat höchstens ein paar Zimmermädchen beschäftigt. Wenn Gualala ein toller Ort gewesen wäre, hätte man ja vielleicht noch sagen können, dass man einen Ortszuschlag rechnen muss, wie ich es in Mendocino erwarten würde, doch was bietet schon Gualala? Höchstens Aufregung, wie ich gleich erfahren durfte:
Als ich meine Kreditkartenabzug habe machen lassen und den Schlüssel bekommen hatte, ging ich zum Auto, um meine Sachen heraus zu holen. Als ich meine „sieben Sachen“ beisammen hatte, konnte ich plötzlich den Zimmerschlüssel nicht mehr finden. Ich habe mich fast verrückt gesucht und konnte und konnte ihn nicht finden. Der Inhaber kam hinzu und meinte, dass das kein Problem wäre und er mir einen Zweitschlüssel geben würde. Er half mir sogar noch, meinen großen Koffer mit nach oben zu tragen, da ich untersuchen wollte, ob der Schlüssel – es war ein sehr kleiner – sich evtl. zwischen den Kleidungsstücken versteckt hatte, als ich etwas rausholen wollte. Ich habe dann oben im Zimmer sämtliche Sachen – auch die, die ich nicht geöffnet hatte – durchsucht, aber nichts gefunden. Später überlegte ich, ob er vielleicht unters Auto gefallen war, und siehe da, da lag er auch. Warum habe ich nicht gleich unters Auto geschaut? (Keinen Kommentar bitte!) Erst nach dieser Aufregung konnte ich mir den Ort ansehen.
Der Innkeeper hatte mir empfohlen, im „Cove Azur“ essen zu gehen. Ich wollte ja schon in der Bodega Bay ein paar Austern schlürfen, doch mitten am Tag – nachdem ich gerade Weintrauben gegessen hatte – konnte ich mir das einfach nicht vorstellen. Doch habe ich sie dann richtig genossen! Danach noch Shrimps Kebab, das waren Schrimps am Spieß, na ja, nicht überragend, doch o. k. Nach dem Essen habe ich meinen Tagesbericht weitergeschrieben und dazu die restliche Flasche Rotwein ausgesüffelt (aus einem Pappbecher, weil´s im Zimmer nichts anderes gab). Kurz vor 8 bin ich noch einmal rausgegangen, um den Sonnenuntergang zu knipsen. Sie geht also gegen 8 Uhr unter und das sieht in Gualala ungefähr so aus:
Und da ich üblicherweise mit den Hühnern ins Bett gehe (hahaha!) oder weil noch immer etwas Jetlag in meinen Gliedern steckt, oder weil ich außer einem Bier und einem Glas Weißwein zum Essen noch den Rest meiner Rotweinflasche von gestern Abend leertrinken musste, oder, oder, oder, verlasse ich meinen Laptop jetzt und will mal sehen, wann ich morgen früh aufwache, und weiterschreiben kann. Also: Gute Nacht, ihr Lieben
Samstag, den 22. August 2009
Es ist nebelig und man sieht kaum das Meer. Wenn ich Meteorologe wäre, würde ich gesagt haben: Das war wohl vorauszusehen. Denn die Luft kühlt nachts ganz schön ab. Ich schätze auf weniger als 15 ° Celsius und nur wenige Kilometer weiter im Landesinnern war es gestern mindestens 30° Grad warm. Da muss doch Dampf entstehen!
Meinen Jet-lag habe ich – glaube ich zumindest – wohl überwunden. Ich war um 4:00 Uhr wach und wollte schon aufstehen, um den Rest des gestrigen Tages niederzuschreiben, doch dann dachte ich mir, versuche doch noch mal, wieder einzuschlafen und es gelang. Kurz nach 7 wachte ich dann auf und jetzt sitze ich zwanzig vor 8 am PC und schreibe diese Zeilen.
Auf dem Flug gen Westen konnte ich mich schon immer schneller an die Zeitumstellung gewöhnen, nur gen Osten hat es immer länger gedauert. Das wird wohl auch diesmal so sein. Doch wir wollen nicht an das Ende denken, sondern erst einmal über den heutigen Tages berichten.
Beim Frühstück mit Blick nach draußen sah ich das: Ein kleiner Kolibri sah mir beim Frühstücken zu und schwirrte dann auch von Blüte zu Blüte, um seinen Nektar und Ambrosia zu bekommen.
Ein kleiner Kolibri sah mir beim Frühstücken zu und schwirrte dann auch von Blüte zu Blüte, um seinen Nektar und Ambrosia zu bekommen.
Als ich losfuhr, fand neben dem Inn gerade der Saturday Market statt. 
Wenn man durch Nebel fährt, sieht alles irgendwie trüber aus:  Wie schön kann man sich diese Küste bei Sonnenschein vorstellen?
Wie schön kann man sich diese Küste bei Sonnenschein vorstellen?
Da der Nebel sich nicht lichtete, entschloss ich mich, nicht weiter an der Küste entlang zu fahren, sondern erneut nach rechts ins Binnenland abzubiegen und zwar hinter Point Arena auf die Mt. View Road. Und das hat sich wirklich gelohnt!
 Mt. View Road: Eine kurvenreiche Strecke mit den tollsten Naturlandschaften, die mich immer wieder jubeln ließen.
Mt. View Road: Eine kurvenreiche Strecke mit den tollsten Naturlandschaften, die mich immer wieder jubeln ließen.
 Wunderschöne Flusslandschaften mit glasklarem Wasser
Wunderschöne Flusslandschaften mit glasklarem Wasser  und die Bäume werden immer größer.
und die Bäume werden immer größer.
 Von hier an ging´s ins Weingebiet des Sonoma Valley.
Von hier an ging´s ins Weingebiet des Sonoma Valley.

 Und immer wieder meine geliebten „Golden Hills“. Wie oft bin ich ausgestiegen, um diese herrlichen Landschaften zu fotografieren.
Und immer wieder meine geliebten „Golden Hills“. Wie oft bin ich ausgestiegen, um diese herrlichen Landschaften zu fotografieren.
In Ukia – einem unaufregenden (um nicht zu sagen: langweiligen) Kleinstädtchen –  kauft ich mit in einem Safeway Supermarkt etwas Obst und eine Flasche Eistee und bin immer wieder begeistert von der Präsentation der Obst- und Gemüseauslagen in den amerikanischen Supermärkten.
kauft ich mit in einem Safeway Supermarkt etwas Obst und eine Flasche Eistee und bin immer wieder begeistert von der Präsentation der Obst- und Gemüseauslagen in den amerikanischen Supermärkten.
 Jede Stadt muss sein USP – Unique Selling Proposition – haben, um sich vom Rest der Welt abheben zu können. So auch das kleine Städtchen Willits mit seinen ca. 5.000 Einwohnern: „Heart of Mendocino County – Gateway to the Redwoods“. Wer sagt´s denn? Man muss sich nur zu verkaufen wissen!
Jede Stadt muss sein USP – Unique Selling Proposition – haben, um sich vom Rest der Welt abheben zu können. So auch das kleine Städtchen Willits mit seinen ca. 5.000 Einwohnern: „Heart of Mendocino County – Gateway to the Redwoods“. Wer sagt´s denn? Man muss sich nur zu verkaufen wissen!
 Doch in Willits habe ich vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen: Statt die 101 weiterzufahren, habe ich den Umweg über die 20 genommen, da diese als besonders sehenswerte Straße gekennzeichnet war. Diese Kennzeichnung hätte man lieber für die 253 nehmen sollen, auf die ich vorher gefahren bin, denn die 20 führt praktisch nur durch hohe Tannenwälder und man kann kaum die Landschaft sehen. Sie endet in Fort Bragg. Auf mich machte er einen langweiligen Eindruck, da er auch noch im Hochnebel lag und somit noch trister wirkte. Schnell hindurch – so gut es geht.
Doch in Willits habe ich vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen: Statt die 101 weiterzufahren, habe ich den Umweg über die 20 genommen, da diese als besonders sehenswerte Straße gekennzeichnet war. Diese Kennzeichnung hätte man lieber für die 253 nehmen sollen, auf die ich vorher gefahren bin, denn die 20 führt praktisch nur durch hohe Tannenwälder und man kann kaum die Landschaft sehen. Sie endet in Fort Bragg. Auf mich machte er einen langweiligen Eindruck, da er auch noch im Hochnebel lag und somit noch trister wirkte. Schnell hindurch – so gut es geht.
 Hinter Fort Bragg riss die Nebelwand wieder auf, doch über dem Wasser hielt er sich hartnäckig.
Hinter Fort Bragg riss die Nebelwand wieder auf, doch über dem Wasser hielt er sich hartnäckig.
Schon faszinierend, wie der Nebel das Bild in eine ganz andere Stimmung bringen kann.
 Sieht schon aus wie die kochende See, oder?
Sieht schon aus wie die kochende See, oder?
 Bei Westport verlässt die Traumstraße Nr. 1 die Küste, weil die Straßenbauingenieure es als nahezu unmöglich erachtet haben, sie weiter an der Küste entlang zu bauen. Man nennt sie daher auch „Lost Coast“ und es ist der entlegenste Küstenabschnitt zwischen Alaska und Kalifornien.
Bei Westport verlässt die Traumstraße Nr. 1 die Küste, weil die Straßenbauingenieure es als nahezu unmöglich erachtet haben, sie weiter an der Küste entlang zu bauen. Man nennt sie daher auch „Lost Coast“ und es ist der entlegenste Küstenabschnitt zwischen Alaska und Kalifornien.
Ich weiß noch, wie ich vor über 20 Jahren mit meinem Sohn Nils die Route No. 1 gefahren bin und er zum ersten Mal mit seinem in Provo/Utah gemachten Führerschein über diese herrliche Straße mit seinen vielen Kurven gefahren ist. Doch die letzte Strecke, wo die 1 vom Pazifik weg ins Land nach Legget zur 101 führt, hat ihm wirklich etwas ausgemacht, wie er mir danach beichtete. Wer hier nicht wirklich weiß, wie man Kurven zu nehmen hat, der kann schon ins Schwitzen kommen, ganz besonders, wenn man Führerschein-Neuling ist. Hier lernt man wirklich Autofahren und danach weiß man, wie das Auto in der Kurve reagiert (oder auch nicht…).
Bevor man in Legget auf die 101 kommt, sieht man folgendes Schild:  Lassen Sie sich nicht täuschen. Es wird zwar diesen Baum mit der Durchfahrt geben, doch vorher werden Sie abgezockt und müssen 5 $ bezahlen! Wäre der Preis der Durchfahrt durch den Mammutbaum auf dem Werbeschild angekündigt worden, hätte ich es mir ja noch gefallen lassen. Doch so steht man plötzlich auf einem Einbahnweg vor einem Kassenhäuschen und soll bezahlen! Zur Ehrenrettung muss ich allerdings sagen, dass man, wenn man nicht zahlen will, auch rechts abbiegen und wieder zurückfahren kann. Doch der schlechte Beigeschmack bleibt. So oder so.
Lassen Sie sich nicht täuschen. Es wird zwar diesen Baum mit der Durchfahrt geben, doch vorher werden Sie abgezockt und müssen 5 $ bezahlen! Wäre der Preis der Durchfahrt durch den Mammutbaum auf dem Werbeschild angekündigt worden, hätte ich es mir ja noch gefallen lassen. Doch so steht man plötzlich auf einem Einbahnweg vor einem Kassenhäuschen und soll bezahlen! Zur Ehrenrettung muss ich allerdings sagen, dass man, wenn man nicht zahlen will, auch rechts abbiegen und wieder zurückfahren kann. Doch der schlechte Beigeschmack bleibt. So oder so.
Da ich normalerweise versuche, Autobahnen zu vermeiden, habe ich auch hier die 101 schnell wieder verlassen, denn es gibt eine Parallelstraße, die ist natürlich viel schöner ist und auf der man anhalten kann, wo man will, um sich die Landschaft, den Fluss und natürlich die Redwoods anzusehen. Denn jetzt kommen sie und noch besser sieht man sie auf der „Avenue oft he Giants“!
 Ja, es sind Giganten, diese Mammutbäume, Redwoods oder Sequoias. Sie werden bis über 100 m groß, haben einen Stammdurchmesser bis zu sechs Metern und können weit über 2.000 Jahre alt werden!
Ja, es sind Giganten, diese Mammutbäume, Redwoods oder Sequoias. Sie werden bis über 100 m groß, haben einen Stammdurchmesser bis zu sechs Metern und können weit über 2.000 Jahre alt werden!
Beim Anblick dieser Riesen kommt schon Ehrfurcht auf und ich dachte an meinen Aufenthalt in England im uralten „Mairmaid Inn“ in Rye, wo ich meine Gedanken über den Baum bei einer Flasche Wein unter dem Titel „Ich wollt ich wär ein Baum“ niedergeschrieben und inzwischen auf meinen Internetseiten veröffentlicht habe. Hier möchte ich noch viel mehr ein Baum sein, denn die Straßenführung richtet sich nach den Bäumen und nicht umgekehrt!
 Sie passen nicht mal im Hochformat ins Bild …
Sie passen nicht mal im Hochformat ins Bild … …und sind auf jeden Fall breiter als mein Auto
…und sind auf jeden Fall breiter als mein Auto
 Es gibt sie als lebende Sehenswürdigkeit
Es gibt sie als lebende Sehenswürdigkeit  oder tote Mächtigkeit
oder tote Mächtigkeit
Doch selbst die umgestürzten Mammutbäume sind noch nützlich: sie sind gewissermaßen wie eine Amme, die die jungen Triebe neuer Bäume mit den nötigen Nährstoffen versorgt. So wachsen auf den alten Stümpfen oder umgestürzten Bäumen neue, wie hier – hoffentlich – deutlich zu sehen ist.
 Schon in den Flusstälern heben sich die Mammutbäume von den „normalen“ Nadelbäumen ab.
Schon in den Flusstälern heben sich die Mammutbäume von den „normalen“ Nadelbäumen ab.
Am Ende der Straße der Giganten war ich vom vielen Schauen langsam müde geworden und suchte mir eine Bleibe für die Nacht. Ich fand sie auch in dem einfachen  „Humboldt Gables Motel“ in Rio Dell, was mich allerding auch über 100 $ kostete! (Mammutbaum-Zuschlag nennt man das denn wohl!) Doch es muss wohl eines der bekanntesten und bedeutendsten Motels der Welt sein, denn der Innkeeper – er war es wohl – erzählte mir in seinem 1 qm großen Kabüffchen (oder waren es gar 1,5 oder sogar 2 qm?), dass er schon Gäste aus allen – nicht etwa aus vielen – Ländern dieser Welt zu Gast hatte! Und ich als Hotelier und Reiseschriftsteller kannte es nicht. Welche Schande für mich!
„Humboldt Gables Motel“ in Rio Dell, was mich allerding auch über 100 $ kostete! (Mammutbaum-Zuschlag nennt man das denn wohl!) Doch es muss wohl eines der bekanntesten und bedeutendsten Motels der Welt sein, denn der Innkeeper – er war es wohl – erzählte mir in seinem 1 qm großen Kabüffchen (oder waren es gar 1,5 oder sogar 2 qm?), dass er schon Gäste aus allen – nicht etwa aus vielen – Ländern dieser Welt zu Gast hatte! Und ich als Hotelier und Reiseschriftsteller kannte es nicht. Welche Schande für mich!
Er erzählte mir auch und markierte dies auf einer Karte, was ich mir alles auf der „Avenue of the Giants“ anschauen müsste, obgleich ich gerade über diese angereist war und es ihm auch sagte. Doch das interessierte ihn nicht, sondern er meinte nur, ich müsste mir unbedingt den umgestürzten Mammutbaum ansehen. Das war einmal der größte lebende und ist nur der größte tote Redwood. Wie schön!
Nachdem er mir noch ein tolles Steakhouse einige Meilen weiter nördlich auf dem Highway 36 empfohlen hatte, brachte ich erst einmal meine Sachen aufs Zimmer, um mich dann daran zu machen, das Steakhouse aufzusuchen. Ich fuhr und fuhr und konnte es einfach nicht finden. Vielleicht sind seine und meine Entfernungsmaßstäbe zu unterschiedlich, sodass ich es nach ca. 10 oder 12 Meilen in Hydesville schließlich aufgab und umkehrte.
Zurück im Ort bestellte ich mir in der „Pizza Factory“ eine „small“ Pizza zum Mitnehmen, denn diese Pizzaria war sowas von ungemütlich, dass ich keine Lust verspürte, dort mein Abendmahl einzunehmen. Ich musste über 25 Minuten warten und durfte für die Pizza 12,50 $ zahlen. Mahlzeit, kann ich da nur sagen!
Die Zeit vertrieb ich mir, in dem ich dem Baseballspiel im Fernsehen zuschaute, ein Spiel, das ich nie verstehen werde. Vielleicht erklärt mir das irgendwann irgendwer einmal, bevor ich das Zeitliche segne. Als Kind haben wir immer Schlagball gespielt, doch das war wohl doch etwas anderes, obgleich ich in all den Jahren diese Spielregeln auch schon vergessen habe.
Und nun ist es schon wieder 10 nach 10 geworden und es wird Zeit, ins Bett zu gehen. Die Flasche Rotwein für 1,99 $ plus Tax ist fast leer und morgen sollte ich mir wohl Nachschub in Eureca besorgen, damit ich nicht gar noch Wasser trinken muss! Gute Nacht.
Sonntag, den 23. August 2009
„Wie fröhlich bin ich aufgewacht, wie habe ich geschlafen so sanft die Nacht“. Dieser Spruch aus Kindheitstagen kam mir in den Sinn, als ich kurz vor sieben aufgewacht bin. Ich hatte also über acht Stunden durchgeschlafen und das ist ein Zeichen dafür, dass ich den Jetlag überwunden habe.
Der erste Blick aus dem Fenster: Nebelig. 
Wie soll ich da die Schönheiten der viktorianischen Häuser in Ferndale und Eureka bewundern können, wenn sie sich alle in mausgraues Tuch kleiden? Da muss ich mir wohl doch eine andere Route aussuchen, als erneut die Küste weiterhin abzufahren, denn da können ja keine schönen Fotos und herrliche Eindrücke entstehen, wenn mir jeden Tag der Küstennebel über die Hälfte des Tages die Landschaft ver-grau-lt.
Da dieses Motel kein Frühstück im Programm hat, musste ich mir wohl oder übel den Rest der Pizza von gestern Abend in der Mikrowelle (die es im Zimmer gibt) wieder aufwärmen, damit ich nicht ganz hungrig auf die Piste gehe. Meinen early-morning-tea hatte ich mir schon gleich nach dem Aufstehen gemacht. Das finde ich so toll an amerikanischen Hotels, Motels, B&B`s etc. dass es schon fast zum Standard gehört, diese Fazilitäten zur Verfügung zu stellen. In meinem Hermes Hotel in Oldenburg haben wir es schon probiert, doch kein Gast hat den Service in Anspruch genommen, also haben wir ihn wieder abgeschafft. Dafür aber am Empfang frischen Kaffee und Teewasser bereit gestellt und das wird dankend genutzt. Andere Länder – andere Konsumgewohnheiten, kann man da nur sagen.
Apropos Alternativroute. Wenn ich mir die Karte so ansehe, geht von Fortuna (schöner Name, da möchte man seine Adresse haben, denn es klingt doch sehr positiv, oder?) die Route 36 gen Osten nach Redding und von da weiter gen Osten auf die Strecke, die ich eigentlich für die Rückreise geplant hatte. Aber es gibt auch eine „scenic route“ von Arcata die 299 und dann die 96 gen Norden, die auch interessant sein könnte. Hier soll der Mount Shasta sehr schön sein. Nun, mal sehen, wie sich das Wetter entwickelt, denn der zweite Blick aus dem Fenster ließ schon blaue Flecken erkennen (nicht an meinem Körper natürlich, sondern am Himmel!) Also erst mal unter die Dusche und dann die restliche Pizza und dann sehen wir mal.
Beim dritten Blick aus dem Fenster – es ist jetzt schon viertel vor acht – kamen die ersten Sonnenstrahlen durch. So werde ich jetzt auf jeden Fall erst mal nach Ferndale und dann nach Eureka fahren und dann entscheiden, wie es weiter gehe soll.
Als ich den Ort Rio Dell verlassen wollte, habe ich noch ein Bild von diesem mächtigen Baum gemacht:
 Und siehe da, ich dachte wieder: „Ich wollt ich wär ein Baum!“ Da hat dieser Kerl doch tatsächliche eine Brücke zerstört und statt man ihn in kleine Stücke haut und in den Kamin zum Heizen schmeißt, setzt man ihm ein Denkmal! Bäume haben es halt besser als Menschen, denn die würde man in den Knast werfen!
Und siehe da, ich dachte wieder: „Ich wollt ich wär ein Baum!“ Da hat dieser Kerl doch tatsächliche eine Brücke zerstört und statt man ihn in kleine Stücke haut und in den Kamin zum Heizen schmeißt, setzt man ihm ein Denkmal! Bäume haben es halt besser als Menschen, denn die würde man in den Knast werfen!
Nach diesen weiteren philosophischen Gedanken über den Baum bin ich los, doch nicht nach Ferndale und Eureka gefahren! Je weiter ich gen Westen fuhr, umso nebliger wurde es wieder. Wenn ich geglaubt hatte, Fortuna würde mir Glück bringen: war nicht so. Ich bin zwar dort abgebogen und durch den Ort gefahren, doch landete ich auf dem Weg nach Osten in einer Sackgasse am Golfplatz. War natürlich vorher nicht angekündigt, sondern erst am Golfplatz! Da ich nicht Golf im Nebel spielen – obgleich ich gerne Golf spiele, wenn auch die frühere Euphorie nicht mehr aufkommt, wenn ich einen Golfplatz sehe, – sondern schöne Landschaften in der Sonne sehen wollte, machte ich also einen U-Turn und fuhr – zum Glück nur ca. eine Meile – zurück ins Glücks-Dorf. Dort bog ich dann links ab und war dann auch auf der richtigen Straße.
Sie führte mich nach Hydesville, wo ich gestern Abend frustriert umgekehrt bin, weil ich das Steakhouse nicht finden konnte. Einen Ort später allerdings sah ich es dann: in Carlotta. Auf der Speisekarte, die ich immer noch im Auto hatte, war weder Ort noch Telefonnummer noch sonst was angegeben. Wäre ja mal ein Tipp für die Inhaber, diese Infos auf die Karte zu drucken, wenn sie sie denn in Motels auslegen lassen. Doch habe ich mir auch überlegt: Auf welcher normalen Speisekarte ist die Anschrift vermerkt? Ich glaube auf keiner!
So fuhr ich die 36 immer weiter nach Osten in der Hoffnung, irgendwann mal aus dem Hochnebel herauszukommen.
Ich sah wiederholt den Van Duzen River, über den – wie bei fast allen Brücken, die ich gesehen habe – immer eine „Memorial Bridge“ führt, mit der eine Berühmtheit geehrt wird.
Wenn ich doch endlich auch mal so berühmt werden würde, dass eine Brücke nach mir benannt wird. Das dürfte dann allerdings höchstens die kleine Holzbrücke werden, die Max und Moritz zersägt haben, um den Schneider Böck eins auszuwischen.
Hier das Zitat aus Wilhelm Buschs „Max und Moritz“:
Nämlich vor des Meisters Hause
Floß ein Wasser mit Gebrause.
Übers Wasser führt ein Steg
Und darüber geht der Weg.
Max und Moritz, gar nicht träge,
Sägen heimlich mit der Säge,
Ritzeratze! voller Tücke,
In die Brücke eine Lücke.
Als nun diese Tat vorbei,
Hört man plötzlich ein Geschrei:
„He, heraus, du Ziegen-Böck!
Scheider Schneider, meck, meck, meck!“
Alles konnte Böck ertragen,
Ohne nur ein Wort zu sagen;
Aber wenn er dies erfuhr,
Ging’s ihm wider die Natur.
Schnelle springt er mit der Elle
Über seines Hauses Schwelle,
Denn schon wieder ihm zum Schreck
Tönt ein lautes: „Meck, meck, meck!“
Und schon ist er auf der Brücke.
Kracks, die Brücke bricht in Stücke!*
Wieder tönt es: „Meck, meck, meck!“
Plumps, da ist der Schneider weg!
 Das könnte dieser alten Brücke auch passieren.
Das könnte dieser alten Brücke auch passieren.
Weiter ging´s mit viel Nebel.
Nach über 35 Meilen war es dann endlich so weit:  Der Nebel verschwindet und der strahlend blaue Himmel wird sichtbar. Da kommt Freude auf! Jubidubidiii!
Der Nebel verschwindet und der strahlend blaue Himmel wird sichtbar. Da kommt Freude auf! Jubidubidiii!
 Ich glaube sagen zu können: „Ich liebe die Coast Range!“ oder finden Sie diese Ausblicke nicht auch wunderschön? Ich bin einfach immer nur begeistert, wenn ich diese Mischung aus goldgelbem, haferähnlichem Gras bzw. Naturgetreide – oder was es auch immer ist – und die dazwischen gesprenkelten grünen Bäume sehe. Einfach herrlich!
Ich glaube sagen zu können: „Ich liebe die Coast Range!“ oder finden Sie diese Ausblicke nicht auch wunderschön? Ich bin einfach immer nur begeistert, wenn ich diese Mischung aus goldgelbem, haferähnlichem Gras bzw. Naturgetreide – oder was es auch immer ist – und die dazwischen gesprenkelten grünen Bäume sehe. Einfach herrlich!
 In the middle of nowhere bei Mad River ein Flugplatz? Wozu das?
In the middle of nowhere bei Mad River ein Flugplatz? Wozu das?
 Das ist wohl mal eine Fabrik oder ähnliches gewesen, und das ist davon übrig geblieben: Schrott!
Das ist wohl mal eine Fabrik oder ähnliches gewesen, und das ist davon übrig geblieben: Schrott!
Ich befand mich übrigens im Humboldt Trinity. Dieser Alexander von Humboldt war wirklich ein Genie! Was dieser Forscher auf der Welt – ob in Nord- und Südamerika oder in Asien – entdeckt und wissenschaftlich erforscht hat, geht über mein kleines Hirn weit hinaus. Und das im 18. und 19. Jahrhundert, als es noch keine Autos, geschweige denn Flugzeuge gab, mit denen er die Welt bereisen konnte. Das kann man nur mit Hochachtung und Hutabziehen bewundern und muss sich ehrfürchtig verneigen. Daher hat man auch hier im fernen Nordwesten der USA nicht nur ein Fort, eine Universität (nicht nur eine, sondern mindestens zwei), eine Bucht und einen Ort, sondern auch die Region (habe ich was ausgelassen?) nach ihm benannt.
Warum man die Region auch Trinity nennt, ist mir schleierhaft, denn mit „Dreifaltigkeit“ hat diese Region nach meiner Ansicht nun wirklich nichts zu tun, es sei denn, dass man Flüsse, Berge und Wald als Dreifaltigkeit herbeizieht, doch das hat dann wohl eher mit Einfältigkeit oder Dummheit zu tun…
Also, was macht man als moderner Mensch? Man schaut ins Internet und findet dann bei Wikipedia (Fangen Sie jetzt nicht an, mit mir über den Wahrheitsgehalt von Wikipedia an zu diskutieren, das lehne ich ganz einfach ab!). Also was habe ich gefunden?
„Seinen Namen hat das County vom Trinity River, der seinerseits 1845 durch Major Pearson B. Messwert benannt wurde, der den irrtümlichen Eindruck hatte, der Strom würde in die Trinidad Bay fließen.“
Trinidad, CA. liegt nördlich von Eureka, nicht etwa in der Karibik vor Venezuela. So, nun wissen Sie es und ich auch (wenn´s denn stimmt…)
Doch was soll´s. Es ist schon eine wunderschöne Gegend und man tut sich schwer, zu entscheiden, welche Stecke man fährt. Das ging mir natürlich auch so. Ich entschied mich für die 299 nach Lewiston, weil ich dachte, das könnte was mit Clark und Lewis zu tun haben, die den Landweg nach Westen erkundet haben. Doch dem ist nicht so, denn die sind viel weiter nördlich unterwegs gewesen, wo ich hoffentlich noch hinkommen werde. Dieser Ort ist nach Benjamin Franklin Lewis benannt worden, der ein Adoptivsohn von Thomas Palmer war, der hier eine Brücke und den Ort erbaut hatte, wie auf einer Tafel vor dem kleinen Cafe nachzulesen ist.
Doch mit einem Entdecker, der nach Lewis und Clark diese Region durchforstet hat, hat der Ort Lewiston offenbar doch zu tun, mit Jededaih Smith, der 1826 auch am Trinity River war und dem man hier dieses Denkmal gesetzt hat.
 Und das ist das Denkmal des berühmten Jededaih Smith in Lewiston, des ersten weißen Trappers, der den Westen bis zum Pazifik erkundete. (So steht es jedenfalls auf der Tafel, obgleich Alexander Mackenzie schon am 22. Juli 1793 den Pazifik auf dem Landwege erreicht hatte, wie ich im Internet herausgefunden habe).
Und das ist das Denkmal des berühmten Jededaih Smith in Lewiston, des ersten weißen Trappers, der den Westen bis zum Pazifik erkundete. (So steht es jedenfalls auf der Tafel, obgleich Alexander Mackenzie schon am 22. Juli 1793 den Pazifik auf dem Landwege erreicht hatte, wie ich im Internet herausgefunden habe).
 “Resturant“!? Muss ich meine englischen Kenntnisse verbessern oder ist das etwa amerikanisch? Wenn so auch das Essen ist, braucht man sich nicht zu wundern, dass das historische Lewiston Hotel zum Verkauf steht…
“Resturant“!? Muss ich meine englischen Kenntnisse verbessern oder ist das etwa amerikanisch? Wenn so auch das Essen ist, braucht man sich nicht zu wundern, dass das historische Lewiston Hotel zum Verkauf steht…
Hier in Lewiston habe ich wieder eine Entscheidung treffen müssen, ob ich nun zurück auf die 299 fahre oder die als „Scenic byway“ ausgeschilderte Strecke nehmen sollte. Zunächst wollte ich mir jedoch die Fish Hatchery ansehen, doch es war Sonntag und alles geschlossen.
Also entschloss ich mich, die Route entlang des Stausees zu fahren, was jedoch nicht möglich gewesen wäre, wenn ich am Ort nicht noch eine Tankstelle gefunden hätte, denn es war nicht zu erwarten, dass ich mit einem fast leeren Tank ohne auf der Strecke liegen zu bleiben, bis zur nächsten Tankstelle gekommen wäre.
 Der Trinity-Damm mit dem dahinter aufgestautem Lewiston Lake, Ende August nur noch wenig Wasser drin
Der Trinity-Damm mit dem dahinter aufgestautem Lewiston Lake, Ende August nur noch wenig Wasser drin
Irgendwann bin ich über eine Brücke rechts nach Castella abgebogen. Doch entweder stimmt meine Karte nicht oder es ist eine Straße zu früh gewesen, auf jeden Fall wunderte ich mich, dass die Sonne nicht von rechts hinten schien, sondern meist von vorne oder halb rechts. Ich fuhr also nicht nach Osten sondern gen Süden! Nun, bei den vielen Kurven und Serpentinen kann das schon mal vorkommen. Doch es ging auch nicht abwärts, sondern immer weiter bergan. Plötzlich ging die tolle Asphalt- in eine Schotterstraße über und ich las ein Hinweisschild, dass jetzt eine „Primitive Road“ zu erwarten ist „without signs“.
Na, das ist ja toll, dachte ich und überlegte, was, wenn ich nicht alleine, sondern zu zweit gereist wäre, meine Begleitperson wohl gesagt hätte. Ihre ängstlichen Blicke, das verkrampfte Festhalten am Sitz oder an der Wagentür, sowie verstohlene Blicke nach links zum Fahrer oder gar die Frage: „Sind wir hier auch richtig?“ hätten mich zum Lügner und großen Tröster machen müssen: „Na klar. Brauchst keine Angst zu haben!“ Man gut, dass ich alleine war…
 Die Ausblicke waren natürlich phantastisch. Ich fuhr zum Schluss praktisch auf dem Bergrücken, denn rechts schimmerte in tiefer Tiefe der Lewiston Lake und links eine andere Schlucht. Wie auf dem Kraterrand auf den Azoren, die ich im letzen Jahr besucht hatte.
Die Ausblicke waren natürlich phantastisch. Ich fuhr zum Schluss praktisch auf dem Bergrücken, denn rechts schimmerte in tiefer Tiefe der Lewiston Lake und links eine andere Schlucht. Wie auf dem Kraterrand auf den Azoren, die ich im letzen Jahr besucht hatte.
 Und hoch über mir kreisten schon die Geier! Oder sind es Adler?
Und hoch über mir kreisten schon die Geier! Oder sind es Adler?
Doch dann sah ich das:
 Aus der Ferne leuchtete schon der Mt. Shasta mit seinen 14.162 Fuß (4.316 m) herüber.
Aus der Ferne leuchtete schon der Mt. Shasta mit seinen 14.162 Fuß (4.316 m) herüber.
Ich konsultierte natürlich immer wieder die Karte und kam schließlich zu der Überzeugung, dass diese Route in meinem vielgelobten Rand McNally Atlas nicht eingezeichnet war (es ist allerdings auch eine alte Ausgabe von 95/96!) und ich vermutlich irgendwann in French Gulch wieder herauskommen würde. Und so war es denn auch. Die Straße wurde zwar immer schlimmer mit schrecklichen Schlaglöchern drin, die man sehr vorsichtig umfahren musste, denn hier oben in der Einsamkeit, wo kein Auto zu erwarten war, hätte ich eine kleine Herausforderung gehabt, wenn der Reifen geplatzt wäre oder was noch Schlimmeres. Doch Hurra! Es kam mir ein Auto entgegen. Damit muss die Straße auch einen Anfang von der anderen Seite haben und nicht etwa erneut ein Schild wie es heute Morgen am Golfplatz stand: Dead End.
Und siehe da: meine Vermutung war richtig! Plötzlich kamen verstreute Häuser auf und was las ich da: French Gulch.
 Auch hier gedenkt man der Kriegstoten – womöglich aus dem Irak – denn die Inschrift lautet: „All gave some. Some gave all.“
Auch hier gedenkt man der Kriegstoten – womöglich aus dem Irak – denn die Inschrift lautet: „All gave some. Some gave all.“
Zurück auf der 299 kam ich vorbei am Whiskeytown Lake (nicht etwa Whiskey-Lake), ein herrlicher See der von vielen Wassersportlern genutzt wurde. Hier hätte ich gerne übernachtet, doch es gibt kein Hotel am See, erst wieder in Redding, wie mir die beiden netten älteren Damen in der Informationsstelle sagten.
 Schmeckt das Wasser nach Whiskey oder nimmt man es zum Whiskeyherstellen? Die 1 Mill. $-Frage!
Schmeckt das Wasser nach Whiskey oder nimmt man es zum Whiskeyherstellen? Die 1 Mill. $-Frage!
Die Damen in der Info-Stelle hätten – hätte ich sie danach gefragt – es sicherlich auch gewusst, dass es NUR in Redding Hotels gibt und danach auf ewig und drei Tage KEINE Unterkunftsmöglichkeiten mehr – außer für Camper!
Und da ich nicht gerne in – Entschuldigung – für mich langweiligen amerikanisch Provinzstädten übernachte, fuhr ich schnell durch Redding hindurch auf den Highway 44 in Richtung „Lassen Vulcanic National Park“, den ich mir gerne ansehen wollte.

 So fuhr ich Meilen um Meilen, zunächst durch ebenes Grasland mit kleinem Eichenbewuchs und dann durch endlose Tannenwälder. Hin und wieder blitzte ein hoher Berg hervor, das müsste der 7.195 Fuß hohe Mahogany Peak sein.
So fuhr ich Meilen um Meilen, zunächst durch ebenes Grasland mit kleinem Eichenbewuchs und dann durch endlose Tannenwälder. Hin und wieder blitzte ein hoher Berg hervor, das müsste der 7.195 Fuß hohe Mahogany Peak sein.
Ich fuhr und fuhr und kam schließlich auch zum Lassen Vulcanic National Park, doch, ob Sie es glauben oder nicht: Selbst am im Baedeker als Top-Reiseziel mit 2 Sternen ausgewiesenem „Lassen Vulcanic National Park“ gab es kein einziges Motel, Hotel, Inn, Lodge oder sonst etwas, das dazu auserwählt werden konnte, mich zu beherbergen! Kaum zu glauben. Also weiterfahren…
 Links und rechts kamen Lavafelder auf und manchmal hatte ich das Gefühl, da wäre gerade ein Vulkan ausgebrochen, denn die Landschaft war schwarz und verbrannt. Doch es war natürlich kein Vulkanausbruch, sondern normales Feuer gewesen, das hier gewütet hatte. Ich war schon zu faul zum Aussteigen geworden und man konnte auch nicht einfach an der Straße anhalten, denn sie hatte keinen Seitenstreifen und war viel befahren. Daher nur ein Blick aus der Windschutzscheibe auf die verbrannte Erde.
Links und rechts kamen Lavafelder auf und manchmal hatte ich das Gefühl, da wäre gerade ein Vulkan ausgebrochen, denn die Landschaft war schwarz und verbrannt. Doch es war natürlich kein Vulkanausbruch, sondern normales Feuer gewesen, das hier gewütet hatte. Ich war schon zu faul zum Aussteigen geworden und man konnte auch nicht einfach an der Straße anhalten, denn sie hatte keinen Seitenstreifen und war viel befahren. Daher nur ein Blick aus der Windschutzscheibe auf die verbrannte Erde.
Inzwischen war ich schon über 9 Stunden unterwegs und ich merkte, dass ich langsam ein Abendessen, ein erfrischendes Bier und ein Bett gebrauchen könnte. Doch es war nichts dergleichen in Sicht. An der Kreuzung der 89 mit der 299 fuhr ich rechts ab, denn das ist meine ursprünglich geplante Route gewesen – allerdings von Nord nach Süd.
Kurz hinter dieser Kreuzung sah ich im Vorüberfahren ein Schild „Guest Farm“. Ich hatte zwar keine Ahnung, ob eine Guest Farm auch müde Walk In´s für eine Nacht aufnehmen würde, doch ich probierte es. Machte einen U-Turn und fuhr zurück zur Einfahrt und fuhr den ca. 1 – 2 Meilen langen roten Kiesweg bis zur Farm.
Sah alles recht hübsch aus. Vögel und Squirrls begrüßten mich recht freundlich und auch einige Pferde schauten kurz auf, als ich die Guest Farm erreichte, doch sonst ließ sich niemand blicken. Hallo´s und andere Äußerungen halfen auch nichts, so dass ich durchs Haus lief – eine Toilette entdeckte und sie schnell ausnutze – ein leeres, noch nicht wieder gemachtes, sehr ansprechendes Zimmer sah, aber keine Menschenseele. Selbst das „Office“ im Nebengebäude war offen aber leer (man hätte vielleicht die Kasse mitgehen lassen sollen…), so dass mir zum Schluss nichts anderes mehr übrig blieb, als wieder umzukehren und auf die 299 zurück zu fahren. Na, denn man weiter.
Ein Blick auf die Karte suggerierte mir, dass ich wohl auch in den nächsten 100 oder mehr Meilen keine Herberge finden würde, denn wenn schon an einem Touristen-Highlight wie den Lassen Park keine Unterkunft vorhanden ist, dürfte es auf einer eher touristenarmen Gegend wohl noch weniger Möglichkeiten geben. Also erneut U-Turn und zurück zur 89 in Richtung Mount Shasta zur Interstate 5. Da müsste es spätestens ein Motel geben. Und so war es denn auch. So habe ich denn von Redding aus mindestens 150 Meilen zurückgelegt, um ein Motel zu finden!
Und hier bin ich nun im erstbesten Motel, das ich finden konnte, dem „Swiss Holiday Lodge“ am Fuße des 14.162 Fuß hohen Mount Shasta, der mich in der untergehenden Sonne anlächelt, gelandet. Mit 55 $ incl. Tax und Continental breakfast gar nicht so schlecht und ein kleines Schwimmbad mit Hot Jacuzzi gibt es auch in diesem Motel.
 Der mächtige Mount Shasta in der Abendsonne
Der mächtige Mount Shasta in der Abendsonne
Nachdem ich mein Zimmer bezogen hatte, bin ich schräg gegenüber ins „Wayside Inn“ gegangen. Bei einem leckeren Hühnchengericht mit einem herrlichen Guinness und zwei köstlichen Gläschen Merlot habe ich den Tag dann bei romantischem Sichelmond über den westlichen Bergen ausklingen lassen.
So, nun ist es inzwischen ¼ nach 10 und ich bin über 11 Stunden unterwegs gewesen, habe fast 400 Meilen auf meist kurvenreicher Strecke zurückgelegt und bin jetzt einfach müde. Morgen früh werde ich dann weiterschreiben. Gute Nacht
Montag, den 24. August 2009
Das Weiterschreiben habe ich dann auch erst heute Morgen besorgt. Ich bin um 20 nach sechs aufgewacht und es war kein Nebel draußen, sondern klarer Himmel! Irgendwie funktioniert heute Morgen das W-LAN nicht, doch was macht das schon. Gestern Abend hat´s auf jeden Fall noch funktioniert. Inzwischen ist es schon halb 9 und es wird Zeit zu duschen und zum kleinen „Continental breakfast“ nach unten zu gehen.
Apropos Duschen: Waren Sie schon mal in Amerika? Dann kennen Sie es, wenn nicht, müssen Sie sich auf Überraschungen gefasst machen, wenn Sie mal in die USA reisen sollten. Ich habe mich schon immer über die unendliche Kreativität amerikanischer Duschamaturen-Ingenieure gewundert. Es gibt Dutzende, wenn nicht Hunderte verschiedenster Dusch-Armaturen und stets sind sie ohne Beschreibung. Mal muss man ganz einfach nach links oder rechts drehen, um warmes oder kaltes Wasser zu bekommen, mal muss man ziehen, mal nach oben oder unten drücken und mal, wie hier, muss man den Hahn nach rechts drehen. Erst kommt kaltes Wasser und wenn man weiter dreht, kommt dann langsam warmes Wasser. Aber wenn die Dusche vom letzten Mal so eingestellt steht, dass der Strahl direkt auf die Duschtür gerichtet ist, wird man erst mal nass – kaltes Wasser natürlich – und der Fußboden schwimmt, da man den Hahn ja zunächst vor der Dusche andreht und die Tür noch offen steht. Die armen Zimmermädchen, die diese Sauerei immer wieder auffeudeln müssen (oder denken die etwa, was dass doch für blöde Gäste sind, die sich mit der Dusche nicht auskennen?) Soweit meine Abhandlung über amerikanische Duschen. Ich wollte schon einmal ein Buch darüber schreiben…
So, und nun geht´s nordwärts nach Oregon!
 Natürlich nicht mit diesem niedlichen Elektroauto, in dem die Tochter des Innkeepers mit ihrem kleinen Hündchen spazieren fuhr, sondern mit meinem Mietwagen.
Natürlich nicht mit diesem niedlichen Elektroauto, in dem die Tochter des Innkeepers mit ihrem kleinen Hündchen spazieren fuhr, sondern mit meinem Mietwagen.
Das musste ich an der nächsten Tankstelle erst einmal wieder „aufladen“, denn nach meiner gestrigen Tour wird auch ein Auto durstig. Auch noch zwei Flaschen Apfelsaft, denn man selbst braucht unterwegs ja auch etwas Flüssigkeit.
 Der Mt. Shasta verfolgte mich noch eine ganze Weile, denn er beherrscht die Region mit seinen 4.317 Metern – die Zugspitze hat nur 2.962 Meter – doch ganz gewaltig.
Der Mt. Shasta verfolgte mich noch eine ganze Weile, denn er beherrscht die Region mit seinen 4.317 Metern – die Zugspitze hat nur 2.962 Meter – doch ganz gewaltig.

 Selbst als ich schon fast in Oregon war, leuchtete er im Hintergrund immer noch mit seiner weißen Spitze auf.
Selbst als ich schon fast in Oregon war, leuchtete er im Hintergrund immer noch mit seiner weißen Spitze auf.
 „Thank you Orgegon“ habe ich natürlich geantwortet, denn ich bin ja ein höflicher Mensch oder glaube es zumindest zu sein.
„Thank you Orgegon“ habe ich natürlich geantwortet, denn ich bin ja ein höflicher Mensch oder glaube es zumindest zu sein.
Was heißt eigentlich „Legacy“ habe ich mich gefragt, denn meine Englischkenntnisse reichen wohl doch nicht ganz aus, so dass ich mit „legal“ – also gesetzeskonform – in diesem Zusammenhang nichts anfangen konnte. Doch da erweist sich schon wieder das Internet als freundlicher Helfer, denn es bedeutet auch „Erbe“, wie ich später herausgefunden habe. Das macht schon mehr Sinn, denn die ganze Gegend ist das Erbe früherer vulkanischer Tätigkeiten.
Das merkte ich auch gleich hinter dem Klamath-Lake, der nur von der Nordseite hübsch anzusehen ist, von der Westseite sieht man fast nur grüngelbes Acker- und Sumpfland.
Kurz hinter Fort Klamath – in beinahe ödem Flachland – steht plötzlich ein „Vista Point“ und man denkt sich, was ist hier schon besonders sehenswürdig? Nun, ein Schild, das auf den Crater Lake hinweist. Es verdeutlich nämlich, wie der Mount Mazama durch gewaltige Vulkanausbrüche in sich zusammengebrochen ist und den Crater Lake gebildet hat. Der ist so tief, dass man hier, wo dieses Schild steht, praktisch auf der Höhe des Seebodens steht und die Wasseroberfläche 590 m höher liegt! Das klingt ja schon sehr interessant und gewaltig und macht sehr neugierig auf den Crater Lake.
Der Eintritt in den Park kostet 10 $, doch die sind ihr Geld auf jeden Fall wert. Man könnte bis zu sieben Tage mit diesem Ticket im Crater Lake National Park bleiben. So lange wollte ich natürlich nicht im Park bleiben.

 Den ersten gewaltigen Respekt bekommt man schon, wenn man auf der Hochfahrt zum „Rim“, dem Kraterrand, sieht, welche Schlucht sich der kleine Annie Creek ins Gestein gegraben hat. Doch dann ist man – oder zumindest war ich es – von den Socken!
Den ersten gewaltigen Respekt bekommt man schon, wenn man auf der Hochfahrt zum „Rim“, dem Kraterrand, sieht, welche Schlucht sich der kleine Annie Creek ins Gestein gegraben hat. Doch dann ist man – oder zumindest war ich es – von den Socken!
Der Crater Lake ist nicht nur mit sechs Meilen Durchmesser riesig, er ist blauer als das blaueste Blau, das man sich vorstellen kann, und er ist mit 590 m einer der weltweit tiefsten Seen überhaupt. Er ist vor 7.700 Jahren durch gewaltige Vulkanausbrühe entstanden, als die unter dem Berg Mazma gelegene Magmamasse in die Luft geschleudert wurden und das dadurch entstandene Vacuum plötzlich kollabierte und in sich zusammen fiel. Sehr anschaulich demonstrierte dies eine Park Rangerin den Kindern:



 Erst formte sie mittels eines Luftballons und feuchtem Sand einen Berg und dann stach sie mit einem spitzen Stift in den „Berg“ hinein und er implodierte und hinterließ den „Mini-Crater-Lake“. Das war sehr eindrucksvoll, nicht nur für die Kids sondern auch für die Eltern und natürlich auch für mich. Wir alle klatschten Beifall und die Rangerin nahm ihn mit dankbarem Lächeln an.
Erst formte sie mittels eines Luftballons und feuchtem Sand einen Berg und dann stach sie mit einem spitzen Stift in den „Berg“ hinein und er implodierte und hinterließ den „Mini-Crater-Lake“. Das war sehr eindrucksvoll, nicht nur für die Kids sondern auch für die Eltern und natürlich auch für mich. Wir alle klatschten Beifall und die Rangerin nahm ihn mit dankbarem Lächeln an.
Doch nun nicht nur Worte, sondern lassen wir den Crater- Lake für sich selbst sprechen:
Die „Wizard“- oder auch „Zauberer-“ oder „Hexer“-Insel
 Das kleine Eichhörnchen kam so dicht heran, dass meine Kamera den Focus nicht so schnell einstellen konnte.
Das kleine Eichhörnchen kam so dicht heran, dass meine Kamera den Focus nicht so schnell einstellen konnte.
 Diese Kiefernzapfen hatten alle „Nasentropfen“ .
Diese Kiefernzapfen hatten alle „Nasentropfen“ .
Ich hätte gerne etwas länger verweilt und hier auch übernachtet, doch als ich im „Crater Lake Lodge“ fragte, ob noch ein single room frei wäre, lächelte der Manager nur sehr großmütig und meinte: „We are fully booked. You have to book at least six month in advance!” Tja, Herr Diekmann, da wird der Hotelier in Ihnen neidisch, oder?
Na gut. Fahren wir also weiter.  Bis Bend sind es ca. 100 Meilen, die müsste man dann wohl bis 6 Uhr schaffen, denn unterwegs wird’s wohl – wie gestern – keine anständige Bleibe für einen Reisenden wie mich geben.
Bis Bend sind es ca. 100 Meilen, die müsste man dann wohl bis 6 Uhr schaffen, denn unterwegs wird’s wohl – wie gestern – keine anständige Bleibe für einen Reisenden wie mich geben.
 Aus der Ferne grüßte mich zwar der Mount Thielsen mit 9.182 Fuß, doch den sah ich dann fast nie mehr, denn die Straße führte durch Nadelwälder, die den Blick versperrten. Solche Straßen finde ich alle langweilig. Sie sind meist schnurgerade – einmal zählte ich 11 Meilen – und wenn man den Cruiser – den Tempomat – einstellte, konnte man beinahe einschlafen. Da waren mir die kurvenreichen Straßen in der Coast Range doch viel lieber.
Aus der Ferne grüßte mich zwar der Mount Thielsen mit 9.182 Fuß, doch den sah ich dann fast nie mehr, denn die Straße führte durch Nadelwälder, die den Blick versperrten. Solche Straßen finde ich alle langweilig. Sie sind meist schnurgerade – einmal zählte ich 11 Meilen – und wenn man den Cruiser – den Tempomat – einstellte, konnte man beinahe einschlafen. Da waren mir die kurvenreichen Straßen in der Coast Range doch viel lieber.
Vor Bend wollte ich dann doch einmal versuchen, nicht in einem Motel in der Großstadt zu übernachten – Bend hat fast 100.000 Einwohner und ist die am schnellsten wachsende Stadt in Oregon – und bog in Sunriver nach links ab, denn da waren auch drei Hotels/Motels auf dem Hinweisschild an dem Highaway 97 abgebildet. Doch irgendwie muss ich die verpasst haben. Einmal fiel ich sogar auf ein Maklerschild herein, auf dem „Mountain Residence“ stand, und ich dachte, das wäre ein Hotel oder eine Lodge. Nein, es sollte nur ein Haus von einem Real Estate Agent mit diesem cleveren Namen verkauft werden!
Also fuhr ich weiter und kam in eine herrliche Bergregion mit einem See. Sogar ein Skilift war auf dem Mount Barchelor vorhanden in dieser „Three sisters wilderness area“, doch keine Hotel, bzw. das was vorhanden war, war bereits oder noch geschlossen! Diekmann, Diekmann, dachte ich, Du wirst wohl auch nie schlauer: In schönen Gegenden gibt es keine Hotels! (Ich würde hier sofort eines bauen, doch vielleicht rentiert es sich nicht, denn doof sind die Hotelleute hier ja nicht und rechnen können sie bestimmt.) Nun gut, bis Bend sind es noch ca. 25 Meilen, das könnte man bis 7 Uhr schaffen.
Kurz vor Bend sah ich dann ein Schild: „Seventh Mountain Resort“ und bog rechts ab. Ein riesiges Gelände ließ mich einen hohen Preis vermuten (in dem einfachen Inn in Gualala hatte ich ja schon über 165 $ gelöhnt!) doch als der Rezeptionist dann meinte, „as a walk in (so nennt man in unserer Branche – inzwischen auch in Deutschland – die Gäste, die nicht reserviert haben, sondern nur einfach so „hereinspazieren“) I can give you a 10 % discount, so the rate is only 99 $ plus tax.“ Da habe ich natürlich sofort „I take it“ gesagt ohne auch nur zu fragen, ob für senior citizens oder AAA-members noch weitere discounts möglich wären.
 Und siehe da, ich bekam ein sehr schönes Zimmer mit zwei king-size beds und sogar mit einem Balkon. Auf dem Prospekt sah ich dann noch, dass gleich nebenan ein schöner Golfplatz ist und so kam mir der Gedanke, da könnte ich ja auch zwei Nächte bleiben und morgen mal nicht stundenlang Autofahren, sondern eine Runde Golf spielen.
Und siehe da, ich bekam ein sehr schönes Zimmer mit zwei king-size beds und sogar mit einem Balkon. Auf dem Prospekt sah ich dann noch, dass gleich nebenan ein schöner Golfplatz ist und so kam mir der Gedanke, da könnte ich ja auch zwei Nächte bleiben und morgen mal nicht stundenlang Autofahren, sondern eine Runde Golf spielen.
Da es nun schon nach 7 Uhr abends war und ich langsam auch Hunger bekam, habe ich nicht erst lange meinen Tagesbericht geschrieben, sondern mich geduscht und bin dann zum Essen gegangen.
Apropos Dusche. Ich habe zu meiner Liste eine weitere Erfindung hinzufügen können: Diese hier musste ich nach links drehen, um erst kaltes und dann warmes Wasser zu bekommen. Ich drehte bis es warm wurde. Es wurde aber immer heißer je weiter ich drehte, dabei wollte ich es ja kälter haben und drehte zum Anschlag, bis ich merkte, dass dieses System völlig umgekehrt wie normal funktionierte! Schon toll, oder? Da hätte ich mich beinahe verbrüht!
Im Restaurant war ich fast alleine – es war nur noch ein 4er-Tisch besetzt – so dass sogar der Kellner meinte, dass wenig los wäre an diesem Abend. „End of the season“ fragte ich oder weil heute Montag wäre? Er wusste es auch nicht und konnte es sich nicht erklären. Ich hatte aber schon gleich an der Rezeption den Eindruck gehabt, dass wenig zu tun war, denn ich der Lobby sah ich keinen einzigen Menschen sitzen.
Ich verzehrte ein Filetsteak mit Shrimps – „surf and turf“, ganz typisch für Amerika – und dazu eine Flasche Merlot vom berühmten Weingut Robert Mondavi, die ich dann noch mit aufs Zimmer nahm, doch dort nur noch ein Gläschen trank, um dann müde ins Bett zu kriechen.
Ja, kriechen, denn in Amerika kann man ja nicht einfach wie Willy Wacker ins Bett springen und sich die Decke über den Kopf ziehen, sondern man muss unter das eng anliegende Bettlaken kriechen, dabei die Füße anwinkeln, sonst kriegt man sie nicht untergebracht und versucht dann, soweit unter die Decke zu rutschen, dass sie bis zum Hals reicht. Wer das nicht gewohnt ist, wird in der Regel die Decke aus seiner unteren und seitlichen Verankerung reißen und hat dann seine Mühe, sich so zuzudecken, dass es nachts nicht hier oder dort zieht. So habe ich das früher auch gemacht, inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, wie es hier üblich ist. Andere Länder, andere Sitten.
Ich weiß, dass die Amerikaner – und nicht nur die – mit unseren Federbetten Probleme haben, weil diese „Eiderdaunen-beds oder „Fetherbeds“ sich nicht am Fußende festmachen lassen. Auch hierüber könnte man ganze Abhandlungen schreiben und auf dem Weg nach Bend habe ich in einem Ort – ich glaube es war La Pine – sogar ein „Fetherbed Inn“ gesehen.
Dienstag, den 25. August 2009
„Guten Morgen, Herr Diekmann, haben Sie gut geschlafen, Herr Diekmann? Happy Birthday, Herr Diekmann, ich hoffe, dass Sie gesund bleiben, Herr Diekmann“.
Ja, so begrüßte ich mich heute Morgen vor dem Spiegel. Nun gehöre ich auch der 68er Generation an. Nicht etwa zu dem wilden 68er Jahrgang, wie etwa Joschka Fischer oder so (daher bin ich auch nicht Außenminister geworden), sondern nur zu den ganz einfach 68 Jahre alt gewordenen Menschen des Jahrgangs 1941!
Das Wetter ist prächtig – in Deutschland würde man Kaiserwetter dazu sagen – es ist nicht zu heiß, es sollen nur gut 80 ° Fahrenheit = ca. 25 ° Celsius werden, so dass ich Golf spielen kann, ohne im eigenen Schweiß zu baden.
Zur Umrechnung von Fahrenheit zu Celsius wähle ich immer zwei Methoden. Die simple ist: mal 3 durch 10, dann kommt man bei 80 ° auf 24 ° Celsius, und die etwas genauere ist, minus 30 durch 2. Das wären in diesem Fall 25 °. Das sind zwar nicht immer die genauen Umrechnungswerte, doch für den Alltagsgebrauch ganz schnell umzurechnen und somit tauglich.
Nach einem typisch amerikanischen Frühstück mit Bacon and Eggs – ach, da fällt mir ein netter Witz ein – sitze ich jetzt am PC um den gestrigen Tag niederzuschreiben, was nun fast geschafft ist. Den Witz muss ich allerdings noch loswerden, denn er passt so herrlich zu Ham & Eggs und zum bedeutenden Unterschied zwischen einem englischen und amerikanischen Frühstück.
 Bacon and Eggs auf amerikanisch (sunny side up)
Bacon and Eggs auf amerikanisch (sunny side up)
Nun also zum Witz, den ich in abgewandelter Form zum ersten Mal von Norman T. Simpson, dem Auto der Buchreihe „Country Inns and Back Roads“ gehört hatte, als er als „Guest Speaker“ vor über 400 Studenten an der Cornell Universität in Ithaca, der berühmtesten Hotel-Uni der Welt, von seinen Erfahrungen über Hotels in aller Welt einen Vortrag halten sollte.
Dazu muss ich allerding noch eine Vorgeschichte loswerden, die dazu gehört und ebenfalls sehr bezeichnend für Norman Simpson war.
Er hatte mich als Gast mit zu diesem Vortrag genommen und ich flog zum ersten Mal in meinem Leben in einer 4-sitzigen kleinen Maschine und durfte auf dem Co-Pilotensitz Platz nehmen. Whooo! Wir reisten am Abend vorher an und wohnten im Hotel „Stadler Inn“, das zur Uni gehört. Am Abend waren wir zum Dinner mit dem Dean – dem Direktor – einigen Professoren und anderen VIP-Gästen eingeladen. Das ist wie ein Captains-Dinner auf einem Traumschiff! Die Kellner trugen sogar weiße Handschuhe, was ich vorher auch noch nicht kennengelernt hatte (und ich stamme aus der Hotellerie! In was für Läden habe ich nur gearbeitet und übernachtet?).
Zu den VIP-Gästen gehörte auch der Security-Chef vom „Hilton“ in Washington. Nun, dachte ich mir, das ist ja verständlich, dass man bei den vielen wichtigen Politikern aus aller Welt, die dort wohl wohnten, einen Sicherheitschef braucht. Ja, meinte der Security-Chef, als ich mich mit ihm unterhielt, das sicherlich auch, doch in erste Linie wäre es sein Job, den Mitarbeitern auf die Finger zu schauen und Diebstähle zu vermeiden!
Doch warum erzähle ich diese Geschichte? Nun, sie hat direkt mit der Eröffnung des Referates von Norman T. Simpson zu tun.
Am nächsten Nachmittag um 4 Uhr kamen alle Studenten zum „Brownies with Back“ in die Aula. Das ist Tradition an jedem Freitag in der Cornell-Universität, wo der Dean, er hieß damals Back mit Vornamen, zu „Brownies (das sind die kleinen braunen Kekse) with Back“ einlädt und alle Studenten kommen müssen. Das ist Pflicht!
Ein Student führte Norman Simpson auf die Bühne und höfliches Klatschen erscholl. Doch da schwenkte der liebe Norman seine beiden Arme mehrmals von unten nach oben, um die Meute anzufeuern und aus dem zarten Klatschen wurde stürmischer Applaus! Damit hatte er die Zuhörer im Griff und er beherrschte die Scene. „He is a real actor”, dachte ich mir so im Stillen.
Dann begann er: „You know, I arrived last night and stayed in your Hotel, the Stadler Inn. It is the best Hotel of the world! And believe me, I have seen many Hotels.” (Kurz übersetzt für die, die das nicht verstanden haben: “Wissen Sie, ich kam letzte Nacht an und wohnte im Stadler Inn. Es ist das beste Hotel der Welt! Und glauben sie mir, ich habe viele Hotels gesehen.“) Alle starrten gebannt auf den Redner und es wurde mucksmäuschenstill im Saal, denn was wäre wohl das Besondere an dem Stadler Inn, dass dieser vielreisende Hotelexperte es als das beste Hotel der Welt bezeichnet?
„Last night, it was about 10 o´clock – I just want to go to bed – as suddenly it knocked at the door. `Yes please?´ I answered and a man´s voice in front of the door said: `Security service. Do you have a girl in your room?´ `No, no, no!´ I answered. And suddenly the door opened and a wonderful girl stands in my room!” (Also auch noch mal übersetzen: „Letze Nacht, es war gegen 10 Uhr – ich wollte gerade ins Bett gehen – klopfte es an der Tür. `Ja bitte?` antwortete ich und eine männliche Stimme vor der Tür sagte: `Sicherheitsdienst. Haben Sie ein Mädchen auf dem Zimmer?´ `Nein, nein, nein!` antwortete ich. Und plötzlich öffnete sich die Tür und ein wunderschönes Mädchen stand in meinem Zimmer.“)
Sie können sich nicht vorstellen, was da in der Aula los war: Die Menge tobte! Und der Dean schüttelte die kleine Glocke, die Norman ihm vorher gegeben hatte und die er benutzen sollte, wenn er etwas Unpassendes sagen würde. Unglaublich!
Als sich die Menge wieder beruhigt hatte – Norman nahm seine Arme und schwenkte sie nach unten, wie man das so macht, wenn man zur Ruhe bittet – begann er seinen Vortrag. Er erzählte eine dreiviertel Stunde nur Witze und darunter als ersten diesen, den ich heute immer auf mich ummünze: Applepie cup coffe.
Nun der Witz: Als ich zum ersten Mal nach New York kam, konnte ich so gut wie kein Englisch, doch das machte nichts. Ich war von einem deutschen Freund eigeladen worden, der schon Jahre in den USA lebte. Er holte mich vom Flughafen ab und lud mich zum Essen ein und wir redeten nur in Deutsch. So ging das ein paar Tage ganz gut, bis er mir eines Abends sagte, er müsse morgen für ein paar Tage nach Chicago verreisen, da er dort geschäftlich zu tun habe. „Mein Gott“, sagte ich, „was mach ich denn da nur, ich kann doch gar kein Englisch! Und ich muss mich doch ernähren können.“ „Kein Problem“, sagt er. „Da unten gibt es eine Snackbar und da gehst du rein und bestellst Applepie cup coffe.“ „Was ist denn das?“ fragte ich. „Apfelkuchen mit einer Tasse Kaffee“ antwortet er. Nicht schlecht. Ich übte und übte und übte und irgendwann konnte ich den Satz.
Am nächsten Morgen ging ich in die Snackbar, wartete bis ich dran war und stotterte dann heraus: „A-a-a-a-plepie cup coffe“ und ich bekam meinen Applepie und meine cup coffe. Ich war glücklich! Am nächsten Morgen konnte ich schon „please“ dazu sagen und war noch glücklicher. Doch nach wenigen Tagen hing mir der Apfelkuchen und der Kaffee zum Halse raus und ich konnte beides nicht mehr sehen. Zum Glück kam mein Freud aus Chicago zurück und lud mich zu einem wunderbaren T-Bone Steak mit einem herrlichen Bier ein. Da war ich wieder glücklich.
Leider verdarb er mir danach den Abend, denn er sagte, er wäre nicht fertig geworden und müsste noch mal nach Chicago. „Aber ich kann doch keinen Apfelkuchen mit Kaffee mehr sehen, geschweige denn essen!“ sagte ich. „Brauchst Du auch nicht. Bestelle einfach Ham Sandwich.“ „Was ist denn das?“ wollte ich wissen. „Schinkenbrot“ antwortete er. Na, wunderbar. Ich studierte Hamsandwich, hamsandwich, bis ich es schließlich auswendig konnte.
Am nächsten Morgen wartete ich wieder in der Warteschlange in der Snackbar, bis ich dran war und sagte: „H-h-ham sandwich“. „White or rye bread?“ kam mir entgegen. Heh????, was wollte der von mir wissen? „Hhhham sandwich“ sagte ich erneut. „Yeaaah, but white or rye bread“ kam es erneut aus seinem Munde. Ich wusste nicht, was er wollte und wiederholte erneut – nun schon bisschen nervöser, weil ich glaubte, dass er meine Aussprache nicht verstand: „Hhhhhaaaammm saaannndwich“. „Yes, I know. But white or rye bread? Hurry up and don’t make me nervous. All people are waiting. Make a decision, boy!” wurde er etwas lauter und machte mich dadurch noch verwirrter. Was will der Kerl eigentlich von mir? Ich fasste meinen letzten Mut zusammen und begann erneut „Hhhhaaaamm S… Apple pie cup coffe!“ platze ich schließlich heraus. Und ich bekam meinen applepie cup coffe!
Soweit zum Witz, der nun doch etwas länger geworden ist, Ihnen dafür aber – hoffentlich – die Besonderheiten beim Bestellen von Speisen in amerikanischen Restaurants etwas näher gebracht hat. Selbst bei McDonalds!
Und die Moral von der Geschichte oder der Unterschied zu England ist der, dass man in den USA und auch in Kanada immer nachfragt. Möchten Sie weißes oder Roggenbrot? Wie möchten Sie ihr Ei? „Sunny side up“ oder „easy over“ oder, oder. Und das ist in England nicht der Fall. Da bekommt man sein Ham sandwich oder sein Bacon & Eggs so wie es üblich ist und es wird nicht lange nachgefragt.
Vermeiden Sie beim Essen auch stets, nach dem Hauptgang noch einen Nachtisch zu bestellen, wenn Sie nicht in Trouble kommen wollen. Sie werden bebrabbelt wie ein Wasserfall mit Dutzenden von Nachtischen, von denen Sie noch nie was gehört haben und deren Namen so schnell heruntergerasselt werden, so dass Sie höchsten applepie, chocolate cake oder icecream heraushören. Suchen Sie sich schon vorher auf der Karte den Nachtisch aus, den Sie später haben wollen, aber lassen Sie sich nie auf eine Bestellung nach dem Essen ein: Sie erleben ein Desaster!
Doch nun zurück zum Tageserlebnis: Ich habe sehr viel am Laptop gesessen und geschrieben! Und das an meinen Geburtstag! Schande über mich und die Menschheit, die einen „Rentier“ noch so viel arbeiten lässt, dabei soll mit 67 ja das Rentenalter beginnen!
Zunächst musste ich mein Zimmer räumen, weil ich eine Nacht verlängern wollte, dieses Zimmer aber heute Nacht von jemand anders benötigt würde. Dann habe ich bis 2 Uhr nachmittags gearbeitet, um den ganzen Freitag hier niederzuschreiben und meine Norman Simpson Storys zu erzählen.
Aber danach habe ich – sage und schreibe – 6 1/4 Stunden auf dem Widgi Creek Golf Club mit drei wirklich witzigen Typen Golf gespielt.

 Sind das nicht herrliche Kerle! Troy, Jamie und Jim. (kann nicht sagen, wer ist wer, sorry!)
Sind das nicht herrliche Kerle! Troy, Jamie und Jim. (kann nicht sagen, wer ist wer, sorry!)
Bei Zweien und besonders Einem (es werden keine Namen genannt) war Bier, Whisky Cola in hohem Maße mit im Spiel (deswegen habe ich auch nicht gewinnen können!). Dass aber die Golf-Marketenderin auch Bier und Hochprozentiges verkaufte, war auch neu für mich. Ist wohl so üblich in Oregon!? Das Spiel hat über 6 Stunden gedauert und der „Marshall“ – das ist der, der aufpasst, damit nicht getrödelt wird – machte uns mehrmals darauf aufmerksam, dass wir wohl zu langsam spielen würden. Drink and Golf takes time!
Da ich noch ein Bier für die Jungs am „19. Loch“ ausgeben wollte, aber das Glück hatte, dass die Golfbar schon geschlossen war (es war ja schon halb acht), verabschiedete ich mich von den Dreien und fuhr schnell in mein benachbartes Hotel, da ich ja mein Zimmer hatte wechseln müssen und noch einchecken musste.
Ich behaupte mal, die beiden Damen an der Rezeption waren nicht gerade die besten Profis der Branche, denn es dauerte ziemlich lange, bis sie endlich raus hatten, dass ich ja schon Gast war und nur das Zimmer hatte wechseln müssen. Dennoch musste ich erneut meinen Personalausweis vorlegen und mein Cap absetzen, damit sie auch erkennen konnten, dass ich Jens Diekmann war. Am liebsten hätte ich mich als Hotelier vorgestellt, doch das wäre wohl für beide Seiten noch peinlicher geworden.
Nach einer schnellen Dusche – es war erfreulicherweise das gleiche System wie im vorigen Zimmer obwohl dieses Zimmer anders ausgestattet war – ging ich zunächst noch einmal an die Rezeption, denn mir war nicht klar, warum im Zimmer alles wunderbar für einen early-morning-coffe bereit stand, doch nichts für einen early-morning-tea vorhanden war. Das war mich gestern schon aufgefallen, doch da hatte ich noch an ein Vergessen bei den Zimmermädchen gedacht. „You can take your tea here in the lobby” boten sie mir an. “In my underware?” antwortete ich fragend. „You can take a tea-bag with you now“ boten sie mir an, doch statt einer Antwort ging ich lieber, denn es gehörte offensichtlich zur „policy in this hotel“, keine Teebeutel aufs Zimmer zu legen. Bloody management! Kann ich da nur sagen.
Also duschte ich schnell und ging ins Restaurant, um meine Lammkoteletts als Geburtstagsmenu zu genießen. Das tat ich denn auch erneut mit einer Merlot-Flasche von Mondavi (von dem ich jetzt noch den Rest genieße, während ich – mit großer Mühe, denn ich finde die richtigen Tasten nicht mehr sehr zielgenau – diese Zeilen schreibe…).
 Das war my Birthday-Dinner: Lammkoteletts
Das war my Birthday-Dinner: Lammkoteletts
Zwei Tische weiter saßen sechs Personen, deren Sprache mir irgendwie heimisch vorkam. Seit dem ich den Film über die nette Person Eliza Doolittle aus „My fair lady“ gesehen hatte, hatte ich einen Spaß daran, alle deutschen Sprachregionen bis auf 50 km genau zu treffen. Heute geht das zwar nicht mehr ganz so genau, doch ich meinte, es wären Schwaben. So ging ich – natürliche nachdem ich meine Rechnung unterschrieben hatte – am Tisch vorbei und grüßte mit dem Satz: „Von einem Fischkopp herzliche Grüße an die Schwaben.“ Das kam offensichtlich gut an, obgleich ich nicht auf eine Antwort wartete, sondern gleich weiter ging. Deutsche treiben sich auch überall rum, kann man da nur sagen.
Und jetzt komme ich wieder mit meiner Rotwein-Philosophie: Die Menschen sind auf der ganzen Welt alle gleich: Sie lieben, genießen und wollen einfach nur leben! Egal in welcher Welt, egal in welche Religion und egal welchen Alters. Es gibt keine „Untermenschen“ wie es kein Unkraut gibt! Ist das nicht schön?
So, nun habe ich an meinem 68. Geburtstag genug geschwafelt und auch genug Rotwein getrunken. Jetzt geht´s ins Bett! Gute Nacht.
Mittwoch, den 26. August 2009
Da ich mir gestern Abend im Restaurant noch einen Teebeutel habe geben lassen, konnte ich mir heute Morgen – so gegen 8 Uhr – auch einen early-morning-tea machen und brauchte nicht im Schlafanzug in die Halle rüber laufen, die immerhin mindestens 500 m entfernt liegt.
Man kann es zwar nicht unbedingt als Muskelkater bezeichnen, doch die 18 Golf-Löcher spüre ich schon ein wenig in den Knochen. Sind halt schon 68 Jahre alt!
Heute geht’s also weiter und da will ich mir zunächst einmal das Newberry National Vulcanic Monument südlich von Bend ansehen und dann von Mount Paulina Grüße an Pavlina (meine Chefin in Neu Wulmstorf) senden, damit sie sich freut und mich neidisch machen kann, denn nach mir ist – glaube ich – noch kein Berg benannt worden. Danach werde ich mich dann entscheiden, ob ich nordöstlich oder nordwestlich weiterfahre. Beides scheint sehr interessant zu sein, aber beides werde ich mir wohl nicht ansehen können. So viel Zeit habe ich denn doch nicht und es liegt ja noch soooo viel vor mir.
Zunächst möchte ich mit einem – wohl auch meinem – Vorurteil aufräumen: Die Stadt Bend ist viel schöner, als man denkt und als das, was ich bisher darüber gelesen habe. Ich war erstaunt, wie schön die Innenstadt am Fluss Deschutes ist und die sogenannten „gesichtslosen Vororte“, die durch den Boom der letzten Jahrzehnte entstanden sind, fand ich ebenfalls sehr wohnlich, besonders die im Nordwesten, denn von dort hat man einen phantastischen Blick auf die „Three Sisters“ und die anderen Berge der Cascade Mountains.
Nachdem ich kurz durch den Park am Deschamps River geschlendert und mir die schönen alten Häuser angesehen hatte, fuhr gen Süden auf den Highway 97 und machte zunächst kurz Station im 
Hier wollte man allerdings 15 $ Eintritt haben, doch dazu war ich zu geizig, zumal ich auch kein großer Museumsfreund bin.
Viel reizvoller fand ich dagegen dieses kleine possierliche Squirrl, das wohl gewohnt ist, von den Besuchern gefüttert zu werden und somit absolut keine Scheu hatte (wie schon am Crater Lake).
 Ist er nicht possierlich, der Kleine?
Ist er nicht possierlich, der Kleine?
Wieder zurück auf die 97 sah ich kurze Zeit später, dass sich die Autos stauten. Baustelle. Es hat fast eine dreiviertel Stunde gedauert, bis man zur Baustelle kam. Zwischenzeitlich konnte ich schöne Aufnahmen vom Lava Butte mit dem Mt. Barchelor im Hintergrund machen.
 Doch dann schüttelte ich eigentlich nur den Kopf über die – man mag es gar nicht aussprechen – Amerikaner: Da wird eine 4-spurige Autobahn, bei der die eine Seite wegen Bauarbeiten gesperrt ist, die andere 2-spurigen Fahrbahn nur als wechselseitige Einbahnstraße genutzt. Und zwar nur eine Fahrbahn, die andere bleibt LEEEER! Und dann fährt noch jeweils ein Lastwagen mit der Blinkaufschrift „Follow me“ wie auf dem Flughafen voraus! Da kann man sich als Europäer nun an den Kopf fassen. Statt die 2-spurige Gegenfahrbahn als normale Straße zu nutzen, wird so ein Theater daraus gemacht. Ergebnis: Die Autos warteten bis zu 40 Minuten! Ganz toll!
Doch dann schüttelte ich eigentlich nur den Kopf über die – man mag es gar nicht aussprechen – Amerikaner: Da wird eine 4-spurige Autobahn, bei der die eine Seite wegen Bauarbeiten gesperrt ist, die andere 2-spurigen Fahrbahn nur als wechselseitige Einbahnstraße genutzt. Und zwar nur eine Fahrbahn, die andere bleibt LEEEER! Und dann fährt noch jeweils ein Lastwagen mit der Blinkaufschrift „Follow me“ wie auf dem Flughafen voraus! Da kann man sich als Europäer nun an den Kopf fassen. Statt die 2-spurige Gegenfahrbahn als normale Straße zu nutzen, wird so ein Theater daraus gemacht. Ergebnis: Die Autos warteten bis zu 40 Minuten! Ganz toll!
Genau so toll finde ich es – und das passierte 10 Minuten später – dass an jeder kleinen Baustelle eine Frau oder ein Mann mit einem Schild „Stop“ auf der einen Seite und „Slowly“ auf der anderen Seite steht. Es war überhaupt kein Verkehr, doch ich musste beim „Stop“ natürlich halten, weil ein Baufahrzeug entgegen kam. Die Straße war mindestens 50 Meter breit oder mehr. Es musste erst vorbei sein, dann drehte sie das Schild um und ich konnte weiterfahren. Man kann das ganze Spielchen auch als „Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste“ bezeichnen oder als Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Toller Job!
 Doch lassen wir uns den Tag nicht verdrießen, denn jetzt ist Paulinchen dran. Sie wissen ja inzwischen schon, dass meine Hotelchefin in Neu Wulmstorf bei Hamburg eigentlich Pavlina heißt – sie stammt aus der Tschechien – und in Deutsch ist das natürlich Paulina. Es gibt einen Wasserfall, einen Berg und einen See mit ihrem Namen. Womit hat sie das nur verdient?
Doch lassen wir uns den Tag nicht verdrießen, denn jetzt ist Paulinchen dran. Sie wissen ja inzwischen schon, dass meine Hotelchefin in Neu Wulmstorf bei Hamburg eigentlich Pavlina heißt – sie stammt aus der Tschechien – und in Deutsch ist das natürlich Paulina. Es gibt einen Wasserfall, einen Berg und einen See mit ihrem Namen. Womit hat sie das nur verdient?
 Und dann dieser Ausblick vom Paulina Peak auf die Cascade Mountains
Und dann dieser Ausblick vom Paulina Peak auf die Cascade Mountains


 Schluchten und Lavaströme als wäre es gestern gewesen, und diese Geröllfelsen.
Schluchten und Lavaströme als wäre es gestern gewesen, und diese Geröllfelsen.


 Am faszinierendsten fand ich die Obsidian Lava und die sehr aufschlussreichen Erläuterungen dazu:
Am faszinierendsten fand ich die Obsidian Lava und die sehr aufschlussreichen Erläuterungen dazu:
Obsidian ist fast wie Fensterglas, was die Zusammensetzung betrifft, doch wird es durch kleine magnetische Kristalle (Eisenoxyde) schwarz. Und da es schneller abkühlt, können sich die Atome nicht gut organisieren (wie beim Kristallglas) sondern bleiben unorganisiert. Faszinierend!

 Auf vielen Tafeln wird alles sehr gut erläutert
Auf vielen Tafeln wird alles sehr gut erläutert
Nach so viel Berg und Lava bin ich dann auf die andere Seite des Highway 97 zunächst über
 eine unendliche Bahnschiene in die Cascade Lakes Region gefahren.
eine unendliche Bahnschiene in die Cascade Lakes Region gefahren.

 Der rauschende Deschutes River muss für River-Rafting Fans viel Spaß machen.
Der rauschende Deschutes River muss für River-Rafting Fans viel Spaß machen.


 Die idyllischen Cascade lakes sind so richtig wie für Familien mit Kindern gemacht.
Die idyllischen Cascade lakes sind so richtig wie für Familien mit Kindern gemacht.
Die Stadt Bend habe ich dann nordwestlich umfahren und bin dabei durch die bereits vorhin beschriebenen sehr wohnlich aussehenden Vorstädte gekommen, bis ich auf den Highway 20 kam, der mich nach Sisters, einem kleinen netten Ort am Fuße der „Three Sisters“ führte. Heute Nacht wohne ich also bei den drei Schwestern – die sich hoffentlich nicht um mich streiten werden…
Auf der Suche nach einer Bleibe für die Nacht fragte ich zunächst in einer Lodge nach dem Zimmerpreis. Die genannten 199 $ plus tax überschritten denn doch mein Budget. Beim nächsten Versuch in einem Best Western wären es 125 $ plus tax gewesen, doch das wollte ich auch nicht ausgeben. Erst im „Sisters Inn & Suites“ kam ich mit 95 $ plus tax gerade noch auf mein Budget.
Mein Motel  am Abend
am Abend  und am nächsten Morgen
und am nächsten Morgen
 Diesen leckeren Hamburger habe ich mit 10 % Discount im „Coyote Creek“
Diesen leckeren Hamburger habe ich mit 10 % Discount im „Coyote Creek“  gegessen.
gegessen.
So, jetzt ist es schon wieder kurz nach 10 Uhr und ich sollte mich in die Falle begeben. Gute Nacht!
Donnerstag, der 27. August 2009
Guten Morgen! Das Wetter sieht ja wieder gut aus, aber ich muss mich erneut entscheiden, ob ich westlich oder östlich fahre (immer diese Entscheidungen! Könnte ich auch einen typischen Witz darüber erzählen, aber lassen wir das.)
So langsam bewege ich mich im Gebiet der alten Siedler und der „Oregon Trail“ kommt immer näher. Der kleine nette Ort Sisters ist eine Zwischenstation, von der aus die Siedler gen Westen zogen und da wollte ich doch mal versuchen, nachzuvollziehen, mit welchen widrigen Umständen und Strapazen sie es wohl zu tun gehabt haben. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass man es heute – 150 Jahre später – nicht mehr nachvollziehen kann. Ich sage auch warum:
Eigentlich wollte ich von Sisters über die 242 gen Westen bis McKenzie Bridge fahren, doch mein Hotel lag schon etwas außerhalb des Zentrums auf der 126 und so fuhr ich diese Strecke. Das war falsch. So werde ich Ihnen erzählen – auch bildlich darstellen – wie die Siedler vor 150 Jahren gefahren sind, wenn man von fahren überhaupt reden kann.
Zunächst sah alles noch sehr nett mit den „Three Sisters“ aus.  Die Three Sisters, so wie sie vielleicht schon vor 150 Jahren aussahen, allerdings ohne Zäune und Sprinkleranlagen, doch flach und offensichtlich mühelos zu befahren.
Die Three Sisters, so wie sie vielleicht schon vor 150 Jahren aussahen, allerdings ohne Zäune und Sprinkleranlagen, doch flach und offensichtlich mühelos zu befahren.
Doch dann steigt das Gelände langsam aber sicher bergan, und ob man da noch mühelos mit Planwagen durchkam, wage ich mal zu bezweifeln. Und dann endet der Wald plötzlich vor einem riesigen Lavafeld! 

Es sieht aus, als ob es erst vor wenigen Jahren entstanden ist, weil kein Baum und kein Strauch zu sehen ist. Doch weit gefehlt: es ist vor vor über 1.500 Jahren entstanden! Da kommt man ja schon nicht mal mehr zu Fuß durch, ohne sich die Knochen zu brechen, geschweige denn mit Pferd und schwerem Planwagen über den Mckenzie Pass, der immerhin 5.325 Fuß oder 1.623 m hoch liegt. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Siedler unmittelbar am Lava- und Waldrand sich einen Pfad gesucht haben müssen. Anders geht das wohl kaum, denn auch das Waldgebiet wirkte auf mich mehr als unwegsam.
Wie mühsam das Überwinden dieses Passes war, geht auch aus einer Erinnerungstafel für den „Briefträger“ John Tempelton Craig, der hier oben im Dezember 1877 von einem Sturm überrascht worden ist und den man später an dieser Stelle erfroren aufgefunden hat. Und der Mann war sicherlich nicht mit dem Planwagen, sondern wohl eher zu Fuß oder mit einem Pferd unterwegs. Wie also mit dem Wagen hier herüber kommen? Unmöglich, würde ich aus heutiger Sicht sagen.


 Man hat zwar einen prächtigen Ausblick auf den Mt. Washington, doch das hat den Pionieren auch nicht viel geholfen oder gar Mut gemacht.
Man hat zwar einen prächtigen Ausblick auf den Mt. Washington, doch das hat den Pionieren auch nicht viel geholfen oder gar Mut gemacht.
 Mut zum Weitermachen haben vielleicht diese hübschen Vögel gemacht, die es wohl schon damals gab. Sie turnten munter zwischen den Lavasteinen herum und suchten nach etwas Fressbaren. Es gab eine ganze Menge davon, aber fragen Sie mich nicht, wie sie heißen.
Mut zum Weitermachen haben vielleicht diese hübschen Vögel gemacht, die es wohl schon damals gab. Sie turnten munter zwischen den Lavasteinen herum und suchten nach etwas Fressbaren. Es gab eine ganze Menge davon, aber fragen Sie mich nicht, wie sie heißen.
Felix Scott „skirted“, d. h. umging (habe ich mich auch erst im Internet schlau machen müssen) auf einem alten Indianerpfad das Lavafeld mit 50 Mann und kam auf die Hochebene, die sogar einen kleinen stillen See hat, der offenbar voller Fische ist, die munter immer wieder aus dem Wasser sprangen und nach Mücken schnappten (wohl damals genauso wie heute).
Doch dann ging´s wieder bergab und zwar nicht schön langsam aber sicher, sondern richtig steil und zerklüftet. Die heutige Straße ist noch so eng und kurvenreich, dass sie für Lastwagen über 11 m Länge nicht befahren werden darf. Und wie wollte man da mit dem Planwagen runterkommen? Man musste die Lavasteine wegräumen, um überhaupt rüber zu kommen und dann durch enge und steile Schluchten wieder nach unten. 1862 scheint dies zum ersten Mal gelungen zu sein. Wie schon gesagt: Für mich aus heutiger Sicht unvorstellbar.
Unten angekommen konnte man dann den wilden McKenzie River verfolgen, was auch nicht ganz so einfach gewesen sein mag, denn der stürzt sich auch in mehreren Wasserfällen und Kaskaden ins Tal.
 McKenzie River Wasserfälle
McKenzie River Wasserfälle  Daneben fand ich diesen hohlen Baumstamm
Daneben fand ich diesen hohlen Baumstamm
Fairerweise muss ich sagen, dass der McKenzie sich schon auf der Strecke zum Santiem Pass befindet. Das ist die heutige Hauptroute nach Salem und in den Westen, die auch die Lastwagen befahren dürften.
Nachdem ich wieder zurück in Sisters war – ich war schon um ¼ vor 8 Uhr losgefahren – habe ich mir in diesem Lokal  erst einmal ein richtiges Frühstück mit Bacon & Eggs im Ort gegönnt, auf das ich allerdings fast eine halbe Stunde warten musste.
erst einmal ein richtiges Frühstück mit Bacon & Eggs im Ort gegönnt, auf das ich allerdings fast eine halbe Stunde warten musste.
Danach fuhr ich östlich weiter und habe das gemacht, was man als „normaler“ Reisender nicht machen sollte: Der „Loop“ um den Mt. Washington, den ich am Morgen gemacht habe, reicht eigentlich an Eindrücken für einen ganzen Tag aus. Ich wollte mir jedoch auch noch die „painted hills“ und die Fossilien ansehen, die John Day gefunden hatte und fuhr weiter gen Osten. Dabei versuchte ich mir immer wieder vorzustellen, wie die Siedler von 150 Jahren die Strecke in entgegengesetzter Richtung wohl bewältigt haben mochten.
 Durch diese Landschaft mag es ja noch gehen, mit dem Planwagen zu reisen,
Durch diese Landschaft mag es ja noch gehen, mit dem Planwagen zu reisen,  doch solche Schluchten müssen auch erst mal überwunden werden.
doch solche Schluchten müssen auch erst mal überwunden werden.
 An diesem netten Flüsschen konnten die Siedler sich sicherlich auch erfrischen und rasten.
An diesem netten Flüsschen konnten die Siedler sich sicherlich auch erfrischen und rasten.
 Und als sie aus dem „High Desert“ hinunter nach Prinewille blickten, glaubten sie sicherlich im „Gelobten Land“ angekommen zu sein, auch wenn es damals wohl noch keine Golf-Plätze gab.
Und als sie aus dem „High Desert“ hinunter nach Prinewille blickten, glaubten sie sicherlich im „Gelobten Land“ angekommen zu sein, auch wenn es damals wohl noch keine Golf-Plätze gab.
 Aber dieses prächtige Gerichtsgebäude musste schon sein.
Aber dieses prächtige Gerichtsgebäude musste schon sein.
 Auch hier wird es nicht einfach gewesen sein, mit Planwagen durchzukommen. Durch den „Ochoco National Forest“ fuhr ich bis kurz vor Mitchel, um auf die Nebenstraße nach Norden zu den gemalten Hügeln zu gelangen. Eine schöne Landschaft ist es allemal.
Auch hier wird es nicht einfach gewesen sein, mit Planwagen durchzukommen. Durch den „Ochoco National Forest“ fuhr ich bis kurz vor Mitchel, um auf die Nebenstraße nach Norden zu den gemalten Hügeln zu gelangen. Eine schöne Landschaft ist es allemal.
Und dann sah ich sie:


 “The Painted Hills” bei Mitchel
“The Painted Hills” bei Mitchel
Den Umweg über Fossile hätte ich mir sparen können, da er nicht so besonders interessant war, zumal ich ja doch nicht bis zum dritten John Day National Monument bei Dayville fahren wollte. Ich hätte die Straße bei den Painted Hills einfach weiterfahren sollen, um zu Clano Units, den Fossilienfunden zu gelangen.
Inzwischen war es ziemlich heiß geworden, doch zum Glück hatte ich genug zu Trinken dabei, obgleich das Wasser auch schon ziemlich warm geworden war. Als ich endlich ankam, muss es über 100 ° Fahrenheit – also ca. 35 ° Celsius – heiß gewesen sein. Schade, dass mein Auto, das sonst alles konnte, die Außentemperatur nicht anzeigte (oder ich es bisher nicht gefunden habe, wo man es ablesen kann). Es war also wirklich heiß und ich überlegte ernsthaft, ob ich nicht weiterfahren sollte, statt mir die Strapazen einer Wanderung auf einem felsigen Trail bei glühender Hitze antun sollte, denn an dem eigentlichen Ort konnte ich nur diese herrlichen Palisaden-Felsen sehen.
Doch dann fand ich eine Tafel, auf der ein „Trail“ zu den Fossilien aufgezeigt war, der nur ¼ Meile lang sein sollte. Nun, das werde ich wohl noch schaffen, dachte ich mir. Und siehe da, es gab sie auch, die Fossilien:
 Das sind die Versteinerungen eines millionenalten Waldes, der irgendwann untergegangen ist.
Das sind die Versteinerungen eines millionenalten Waldes, der irgendwann untergegangen ist.
 Dann gab es noch ein großes Loch im Felsen und viele kleine (wohnen da etwa Stein-Eichhörnchen?)
Dann gab es noch ein großes Loch im Felsen und viele kleine (wohnen da etwa Stein-Eichhörnchen?)
Auf der Weiterfahrt gab´s in einem kleinen Flecken ein „Café & Shop“ wo ich mir für 2 $ noch 2 Fläschchen Fruchtsaft kaufte, um dann in Richtung Westen weiterzufahren. Genau gegenüber dem Laden hing im Baum ein Thermometer, das ca. 100 ° Fahrenheit – also ca. 35 ° Celsius – anzeigte. Da war es schon später Nachmittag!
 Die Region östlich der „Warm Springs Indian Reservation“ ist wirklich leer, wenn auch nicht ohne Reiz, wie ich finde.
Die Region östlich der „Warm Springs Indian Reservation“ ist wirklich leer, wenn auch nicht ohne Reiz, wie ich finde.
Hat man den Ureinwohnern eigentlich immer nur die wüstesten Gegenden als Domizil gelassen, wie ich dies schon früher öfters empfunden hatte, und die guten für sich behalten? Dazu könnte ich ja wieder meine Kommentare über die Amerikaner abgeben. Doch lassen wir das lieber.
Von weitem sah ich jetzt schon den „Fujiyama der USA“ durch den Dunst schimmern: Mt. Hood.
 Der Mt. Hood, der 11.240 Fuß (3.425 m) in den Himmel ragt.
Der Mt. Hood, der 11.240 Fuß (3.425 m) in den Himmel ragt.
In Maupin traf ich dann wieder auf den Fluss Deschutes, der sich hier einen tiefen Graben in den Sandsteinfelsen gefressen hatte. Doch da ich das Motel nicht besonders einladend fand, bin ich, obgleich ich schon über 9 Stunden reine Fahrzeit hinter mir hatte, weitergefahren.
Inzwischen neigte sich meine Tanknadel auf „Empty“ und so füllte ich den Tank an der nächstbesten Tankstelle auf. Hier lernte ich dann von der Besitzerin, dass es in Oregon ein „Stupid Law“ gibt, wie sie sich ausdrückte, dass man sich an Tankstellen nicht selbst bedienen darf. Auch hier noch etwas zu Trinken mitnehmen, denn sie sagte mir, dass es bis zum nächsten Ort Govenors Camp, in dem es eine Übernachtungsmöglichkeit gibt, noch über 30 Meilen sind.
Kurz nach 7 Uhr abends (ich bin seit kurz vor 8 morgens unterwegs) kam ich dann in diesem Skiort an, in dem auch im Sommer Ski gelaufen wird, denn er liegt am Fuß des Mt. Hood. Es ist offenbar ein Trainingsort für die amerikanisch Ski-Asse – bzw. die es mal werden wollen – denn ich sah viele Teams in ihren mit Werbung überzogenen Autos.
 Es war nicht ganz einfach, ein Zimmer zu bekommen, doch schließlich gelang auch das. 107 $ für ein, na sagen wir mal „bescheidenes“ Zimmer im „Huckleberry Inn“ („The otherone takes double“ meinte der etwas versifft aussehende Innkeeper nur). Es war übrigens das erste Mal, wo der Preis nicht „plus tax“, sondern incl. Tax genannt wurde.
Es war nicht ganz einfach, ein Zimmer zu bekommen, doch schließlich gelang auch das. 107 $ für ein, na sagen wir mal „bescheidenes“ Zimmer im „Huckleberry Inn“ („The otherone takes double“ meinte der etwas versifft aussehende Innkeeper nur). Es war übrigens das erste Mal, wo der Preis nicht „plus tax“, sondern incl. Tax genannt wurde.
Im „Ratskeller“ habe ich noch einen Hamburger gegessen, bevor ich danach – ohne groß Tagebuch zu schreiben – ins Bett gefallen bin.
Freitag, den 28. August 2009
Es war eine schreckliche Nacht! Nicht nur, dass das Zimmer sehr hellhörig war, der Nachbar immer sehr laut die Tür zuschlug bzw. sie ins Schloss fiel, er nach 10 Uhr nachts noch duschte, was sich anhörte, als wäre es meine Dusche, er früh morgens um halb vier sein Auto startete und erneut mehrmals laut mit der Tür klapperte, weil er offensichtlich noch was vergessen hatte. Nicht zuletzt plagten mich zwei ganz schreckliche Albträume, die ich lieber schnell vergesse, bevor ich sie hier aufschreibe. Jetzt sitze ich hier schon seit 2 Stunden am PC, um über den gestrigen Tag zu berichten.
Die Ski-Teams sind schon seit 7 Uhr unterwegs und da dieses bescheidene Zimmer erstaunlicherweise sogar einen Balkon direkt zur Straße hat, höre ich immer wieder anfeuerndes Klatschen und aufmunternde Rufe, während laufend Läufer und Läuferinnen vorbeilaufen (klingt richtig kreativ, das viermalige „Laufen“, toll oder?).
 Neugierig, wie ich nun mal bin, fragte ich die – offensichtlich – Betreuer, was denn los wäre. Es ist der internationale Laufwettbewerb „Hood to Coast“, der über knapp 200 Meilen vom Mt. Hood zum Pazifik mit Teams aus allen Ländern der USA und weiteren 26 Ländern weltweit stattfindet. Hier die Fakten von der entsprechenden Internetseite:
Neugierig, wie ich nun mal bin, fragte ich die – offensichtlich – Betreuer, was denn los wäre. Es ist der internationale Laufwettbewerb „Hood to Coast“, der über knapp 200 Meilen vom Mt. Hood zum Pazifik mit Teams aus allen Ländern der USA und weiteren 26 Ländern weltweit stattfindet. Hier die Fakten von der entsprechenden Internetseite:
- Nike Hood To Coast Relay
- 197 miles
- 12.000 runners
- 28th Annual Year
- 3.500 volunteers
- August 28-29, 2009
- Largest Relay in the World!
- Incredible Adventure with Unbeatable Scenery
- Fundraise for Charity of Choice: American Cancer Society
- From majestic Mt. Hood to beautiful Pacific Ocean in Seaside
Das ist schon toll, oder?
Jedes Team besteht aus 12 Läufern, die 317 km zurücklegen müssen, d. h. jeder ca. 26,5 km! Und das waren keine Profis: von dem 13 jährigen Mädchen über etwas zu dick geratenen Muttis bis zum über 80 jährigen (sicherlich schon) Ur-Opa war alles dabei.
Ich war so begeistert und bewegt, dass mir die Tränen in die Augen kamen (ich bin sehr dicht am Wasser gebaut…) und ich hoch zum Start am historischen Hotel „Timberline Lodge“ gefahren bin, wo in 6.000 Fuß Höhe (ca. 1.800 m) der Staffellauf beginnt, der in Seaside am Pazifik auf Meereshöhe endet.

 Start am Mt. Hood und dann einsam auf die Strecke.
Start am Mt. Hood und dann einsam auf die Strecke.  Begeistert waren alle Teilnehmer, ob die aktiven Läufer oder die passiven Begleiter. Die hatten sich richtig eine gute Zeit gemacht, wie man an den Autos und Verkleidungen sehen konnte. Sie wollen dieses Jahr 350.000 $ zusammen bekommen, nachdem sie letztes Jahr 290.000 $ für die Amerikanische Krebsgesellschaft stiften konnten. (Da muss ich mal mit meinem Sohn Nils reden, der ja schon Marathon gelaufen ist, ob er das nicht mit seiner Münchener Rück auch mal mitmachen und sponsern lassen kann.)
Begeistert waren alle Teilnehmer, ob die aktiven Läufer oder die passiven Begleiter. Die hatten sich richtig eine gute Zeit gemacht, wie man an den Autos und Verkleidungen sehen konnte. Sie wollen dieses Jahr 350.000 $ zusammen bekommen, nachdem sie letztes Jahr 290.000 $ für die Amerikanische Krebsgesellschaft stiften konnten. (Da muss ich mal mit meinem Sohn Nils reden, der ja schon Marathon gelaufen ist, ob er das nicht mit seiner Münchener Rück auch mal mitmachen und sponsern lassen kann.)
Schweren Herzens verabschiedete ich mich von dieser mich sehr ergreifenden Veranstaltung, nicht ohne noch ein schönes Foto vom Mt. Hood gemacht zu haben.
 Mt. Hood fast ohne Schnee
Mt. Hood fast ohne Schnee
Jetzt ging´s weiter gen Norden zum berühmten Columbia River.
 Hin und wieder blickte der Mt. Hood noch mal durch die Tannen, doch von dem Hood River war ich eher enttäuscht: so ein großer Berg und nur so ein kleiner Fluss.
Hin und wieder blickte der Mt. Hood noch mal durch die Tannen, doch von dem Hood River war ich eher enttäuscht: so ein großer Berg und nur so ein kleiner Fluss. 
 Dann kam vor mir schon der Mt. Adams in Sicht (hinten rechts schwach zu erkennen), so dass ich mal nach hinten und mal nach vorne blickte, denn der Columbia River wird praktisch von beiden Bergen in die Zange genommen.
Dann kam vor mir schon der Mt. Adams in Sicht (hinten rechts schwach zu erkennen), so dass ich mal nach hinten und mal nach vorne blickte, denn der Columbia River wird praktisch von beiden Bergen in die Zange genommen.
Die Tannen wichen ausgedehnten Obstfeldern und unwillkürlich dachte ich an Südtirol, wo mitten zwischen den Bergen auch ein ausgedehntes Obstanbaugebiet liegt. Nur mit dem Unterschied, dass hier zwei Riesen – Mount Hood und Mount Adams – über das Tal wachen.
 Und dann lag er vor mir: der geschichtsträchtige Columbia River mit dem Ort Hood River. Nördlich der Brücke über den White Salmon River und südlich davon unter der Brücke: Die „Hobby-Killer“.
Und dann lag er vor mir: der geschichtsträchtige Columbia River mit dem Ort Hood River. Nördlich der Brücke über den White Salmon River und südlich davon unter der Brücke: Die „Hobby-Killer“.
Ich nenne sie deswegen Hobby-Killer, weil sie nicht Angeln gehen, um sich zu ernähren, wie es unsere Vorfahren sicherlich mussten, damit sie nicht verhungerten, sondern aus reinem Spaß. Sprich: Fische aus Hobby töten! Extreme Meinung? Gewiss, doch ich halte es nicht zuletzt auch für Tierquälerei. Aber wenn man auf Malta oder in anderen Mittelmeer-Regionen Singvögel mit Netzen fängt, um sie zu verzehren, dann schreien diese Leute laut: Verboten! Wo ist der Unterschied? Oder wie stark regen sich diese Leute – die Angler – über den Stierkampf auf? Nur, dass sie selbst Tierquäler und Tiermörder sind, wollen sie nicht gelten lassen. Über Jäger könnte man ähnliches schreiben. Doch will ich mich nicht weiter aufregen, sondern lieber weiterfahren, damit ich auch noch den Mt. St. Helens und den Mt. Adams aus der Nähe betrachten kann.
Über eine mautpflichtige historische Brücke fuhr ich nach Washington, dem immergrünen Staat.
Über den Columbia River könnte man ganze Bücher schreiben, was ja auch schon geschehen ist, denn durch ihn sind Lewis und Clark bis an den Pazifik gekommen und umgekehrt sind die ersten Seefahrer auf ihm von der See aus ins Land vorgedrungen, um mit den Indianern Pelztierhandel zu betreiben.
 Was ich allerdings bisher nicht gelesen hatte – ich kenne ja nur ein wenig aus Reiseführern – erzählte mir gestern Abend der Manager im „Ratskeller“: der Columbia bei Hood River ist weltweit als Paradies bei den Surfern bekannt, sowohl bei den Kite- aus auch bei den normalen Surfern. Das liegt daran, dass hier im Flusstal immer ein sehr starker Wind weht. Er entsteht dadurch, dass die heiße Luft über der „High Desert“ – und die ist wirklich heiß, wie ich gestern erfahren konnte – aufsteigt und die Luft vom Pazifik ansaugt, die hier durch das enge Tal geschleust wird. Da ich von der Küste komme, glaube ich, in etwa Windstärken einschätzen zu können und bin davon überzeugt, dass hier mindestens Windstärken von 7 – 8 herrschen. Das ist natürlich für Surfer wirklich ein Paradies. Auf diesem Bild wird nur bedingt deutlich, wie stark der Wind bläst,
Was ich allerdings bisher nicht gelesen hatte – ich kenne ja nur ein wenig aus Reiseführern – erzählte mir gestern Abend der Manager im „Ratskeller“: der Columbia bei Hood River ist weltweit als Paradies bei den Surfern bekannt, sowohl bei den Kite- aus auch bei den normalen Surfern. Das liegt daran, dass hier im Flusstal immer ein sehr starker Wind weht. Er entsteht dadurch, dass die heiße Luft über der „High Desert“ – und die ist wirklich heiß, wie ich gestern erfahren konnte – aufsteigt und die Luft vom Pazifik ansaugt, die hier durch das enge Tal geschleust wird. Da ich von der Küste komme, glaube ich, in etwa Windstärken einschätzen zu können und bin davon überzeugt, dass hier mindestens Windstärken von 7 – 8 herrschen. Das ist natürlich für Surfer wirklich ein Paradies. Auf diesem Bild wird nur bedingt deutlich, wie stark der Wind bläst,
Auf dem Weg durch dichte Tannenwälder kam ich über diese Schlucht:
 Das müsste der Wind River sein.
Das müsste der Wind River sein.
Kurze Zeit später sah ich auf der linken Seite eine „National Fish Hatchery“, die mich lockte. In Lewiston, CA. wollte ich mir ja schon eine ansehen, doch die war am Wochenende geschlossen.
Ich war noch gar nicht ganz aus dem Auto ausgestiegen, da kam mit eine nette Dame mit der Frage entgegen: „May I help You“ und erzählte mir sehr aufschlussreich, was man hier macht. Es werden geschlechtsreife Chinook Lachse, die Königslachse, in den Flüssen gefangen, wenn sie aus dem Pazifik zurück zu ihren Laichplätzen kommen. Die weiblichen Eier werden entnommen und mit dem Samen der männlichen Lachse befruchtet und hier dann in frischem klarem Bachwasser soweit großgezogen, bis sie wissen, wann es Zeit ist, in den Pazifik zu schwimmen.
Das war mir neu, denn bisher war mir nur bekannt, dass die geschlüpften Jungfische das erste Jahr in einem See, der unterhalb ihres – sozusagen – „Geburtsortes“ verbeiben und dann erst ins Meer hinabschwimmen. Wie finden sie denn auf dem Rückweg den Fluss, in dem sie geboren wurden, wenn dies in der Fischzucht stattfand, wollte ich wissen. Nein, meinte die charmante Betreuerin – sie heißt Mary – die Lachse können sich erst dann den typischen Geschmack des Flusses merken, wenn sie sozusagen reif sind, ins Meer zu schwimmen. Nicht schon, wenn sie aus dem Ei geschlüpft sind.
 Und das sind die vielen kleinen Chinook-Lachse, die hier aufgezogen werden. Hunderttausende!
Und das sind die vielen kleinen Chinook-Lachse, die hier aufgezogen werden. Hunderttausende!
Und das ist die charmante Mary. 
Sie hat mir noch viele Broschüren mit allerlei Informationen mitgegeben, doch das kann ich alles hier nicht wiedergeben. Allerdings konnte ich ihr auch etwas zurückgeben, was ich vor ein paar Jahren am Adams-River in Kanada kennengelernt habe, wo die Sockeye Lachse noch auf natürlichem Wege ihren Nachwuchs bekommen: Lachse wachsen immer ohne Eltern auf und haben nie Kinder. Das war ihr neu, zumindest diese Formulierung.
Als ich über den Lewis River kam, machte ich kurz Halt auf dem Parkplatz, um dieses Bild zu machen…
…doch dann musste ich das folgende Bild machen:
 Einen „Platten“ nennt man das wohl oder „Flat tire“ würde man hier in Amerika dazu sagen.
Einen „Platten“ nennt man das wohl oder „Flat tire“ würde man hier in Amerika dazu sagen.
Damit war dann wohl Schluss mit meiner Bergtour. Statt hoher Gipfel platter Reifen!
Wieso dachte ich da an Norwegen, wo mir ähnliches widerfahren ist, oder gar an Toronto im Winter, als ich bei Schneegestöber einen Reifen wechseln durfte? Gehört wohl dazu, oder?
Nun gut: Umdisponieren und erst mal sehen, dass ich den Ersatzreifen raufkriege. Das ging auch recht fix – wobei mir noch kurz ein netter Herr geholfen hat – und in (glaube ich) 15 Minuten war der Ersatzreifen montiert. Noch schnell die Hände im Lewis River abwaschen und dann statt nach Norden zum St. Helens gen Westen zur Interstate 5 (57 Miles!), wo am ehesten die Chance bestand, den Reifen zu reparieren oder einen neuen zu kaufen.
Mit maximal 50 Meilen durfte ich fahren und so dauerte es über eine Stunde, bis ich in Woodland ankam. Gleich am Ortseingang fand ich eine Werkstatt, wo man sich den Schaden näher ansah: ein ca. 2 cm langes und 1 cm breites scharfes Eisenteil steckte im Reifen, das so aussah, wie ein abgebrochenes Teppichmesser. Der Boss schüttelte den Kopf, da er keine Reifen hatte, doch nannte er mir einen Reifenhändler, die „Tire Factory“ am andern Ende des Ortes. Er druckte mir die Route aus dem Internet aus und als ich ihn fragte, was er für seine Hilfe bekommen würde, war es fast beleidigt. Super!
Ich fand die Tire Factory sofort und der Chef – Gary – sah sich den Schaden an, machte nicht viel Worte, nahm den kaputten Reifen, pumpte ihn auf und ging dann damit um die Ecke. „Was will er denn jetzt?“ dachte ich, „Will er ihn etwas gleich entsorgen?“ Doch weit gefehlt. Um die Ecke befand sich nämlich ein Tauchbecken, in das er den Reifen legte und mit einem Hebelwerk wurde der Reifen unter Wasser gedrückt, um zu sehen, an welcher Stelle es blubbern würde. Sehr professionell!
Dann nahm er den Reifen wieder heraus, markierte die Stelle, an der er eine undichte Stelle hatte und ging – immer noch ohne ein Wort zu sagen – in die Halle und demontierte den Reifen. Als er ihn runter hatte, spannte er ihn in ein spezielles Werkzeug, das ich bisher noch nie gesehen hatte, und begann, den Reifen zu flicken! Er nahm eine Bohrmaschine mit einem Schmirgelkopf, mit dem er die Innenseite an der defekten Stelle aufraute, damit der Flicken besser halten würde. Dann nahm er einen 5 x 5 cm großen Flicken und klebte ihn auf die undichte Stelle.
 Gary Roland beim Flicken meines Reifens. Das muss ich mal meinem Reifenhändler in Rendsburg erzählen, denn so ein Gerät hat er bestimmt nicht!
Gary Roland beim Flicken meines Reifens. Das muss ich mal meinem Reifenhändler in Rendsburg erzählen, denn so ein Gerät hat er bestimmt nicht!
Ich hatte natürlich meine Zweifel, ob der Flicken wohl halten würde, denn der Chef in der ersten Werkstatt, der mich hierher geschickt hatte, war auch der Meinung gewesen, dass man den Reifen wohl nicht mehr flicken könnte sondern einen neuen bräuchte, denn er hatte mich gefragt, ob ich gut versichert wäre. Als ich ihm daraufhin sagte, dass dies ein Mietwagen wäre und ich die Police aus dem Wagen holte, lachte er nur, denn da steht doch tatsächlich drin, dass man alle Reparaturen „bis zum Neuwert des Wagens“ selbst bezahlen müsste! (Das Kleingedruckte liest man ja immer erst, wenn was passiert ist. Doch wenn man es gelesen und nicht akzeptiert hätte, hätte man keinen Mietwagen bekommen. Wozu also das Kleingedruckte überhaupt lesen?)
Vorsichtig fragte ich also, ob der Reifen wohl noch mindestens 2.000 Meilen halten würde, die ich ja evtl. noch fahren würde. Da war er offensichtlich fast beleidigt, wie ich an seinen Fähigkeiten zweifeln konnte und murmelte etwas vor sich hin, was ich zwar nicht ganz verstand, vorsichtshalber aber auch nicht nachfragte.
Dann fuhr er mein Auto auf die Rampe – ich durfte das nicht selbst machen – er fragte vorher nur: „Key in the car?“ und ich antwortet mit „Yes“. Er tauschte den Ersatzreifen mit dem Geflickten aus, fuhr das Auto wieder von der Rampe, verstaute den Ersatzreifen im Kofferraum und ging dann in sein Büro, um die Rechnung zu schreiben. Nur 15,60 $. Ich war von den Socken über den günstigen Preis!
Ich fragte ihn noch, ob er mir in der Nähe ein nettes preiswertes Motel empfehlen würde. Das tat er denn auch: „Lewis River Inn“. Erst hinterher überlegte ich, ob ich ihm nicht noch ein gutes Trinkgeld hätte geben sollen, doch da war es schon zu spät, denn ich saß schon wieder im Auto.
 Sieht das nicht einladend aus?! Und so ist es auch: Lewis River Inn. Ein wirklich ein gutes Motel, und das zu einem Preis, der zum ersten Mal wirklich in Ordnung ist: 70,78 $ (ca. 50 €)!
Sieht das nicht einladend aus?! Und so ist es auch: Lewis River Inn. Ein wirklich ein gutes Motel, und das zu einem Preis, der zum ersten Mal wirklich in Ordnung ist: 70,78 $ (ca. 50 €)!
 Hier sitze ich nun und schreibe meinen Tagesbericht über hohe Berge und platte Reifen.
Hier sitze ich nun und schreibe meinen Tagesbericht über hohe Berge und platte Reifen.
Als ob es hätte so kommen sollen: Als ich an der ersten Werkstatt ankam, begann es zu regnen und als ich im Motel angekommen war, hatte der Regen aufgehört. Ich hätte sehr wahrscheinlich sowieso nur Bilder mit wolkenverhangenen Bergen machen können, denn sie wurden immer dichter, je näher ich zum St. Helens kam. Was soll man dazu nur sagen? „Wer weiß, wofür das gut ist!“ hat meine Mutter immer gesagt (Mütter haben doch immer Recht!), oder: Ende gut alles gut.
So, jetzt ist es 20 vor acht am Abend und mein Magen knurrt. Schnell noch unter die Dusche und dann gegenüber zum Mexikaner „Casa Tapatia“, den mir die Rezeptionistin empfohlen hatte.
Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich hätte noch nie mexikanisch gegessen. Doch es ist nicht gelogen, dass ich es zum ersten Mal alleine tat. Früher – als ich noch jung und schön war – hat mich mal jemand in Los Angeles oder wo es auch immer war, zum Mexikaner mitgenommen und mir die verschiedenen Speisen erklärt. Doch jetzt kannte ich unter all den Bezeichnungen nur Guacamole, diesen köstlichen Dip aus Avocados. Alles andere hatte ich vielleicht schon mal gehört, aber anfangen konnte ich damit nichts. So hätte ich mit Sicherheit einen Guide gebraucht, der mir nicht nur erklärt hätte, was ich da esse, sondern auch, wie ich das alles essen muss. Die Chefin vom „Casa Tapatia“ erklärte mir zwar, dass man in die Enchiladas alles einwickelt und häppchenweise davon isst (wenn ich das richtig verstanden habe). Doch ich habe mich nur auf die köstlichen Scampies „Fajitas el Rey“ konzentriert, die in einer Pfanne brutzelnd serviert wurden. Sehr lecker!
Sonnabend, den 29. August 2009
Happy Birthday, lieber Horst, denn heute hat mein Bruder Geburtstag. Hoffentlich hat er meine Karte aus den USA rechtzeitig bekommen, was ich allerdings nicht glaube, denn die Dame in der Post sagte mir, es dauere 7 Tage (und das im 21. Jahrhundert, wo man in 10 Stunden von Deutschland nach Kalifornien fliegen kann!). Da denkt man unwillkürlich an die Operette „Christl von der Post“ von Karl Millöcker: „Denn bei der Post geht’s nicht so schnell…“. Dass war noch im 19. Jahrhundert und etwas leicht ironisch gemeint. Heute sind wir im 21. Jahrhundert und leben im Internet-Zeitalter!
Ich wollte heute über McMinnville, dem Zentrum des Weinbaus in Oregon, an die Küste, um dann nordwärts zu fahren. Da ich keine große Lust hatte, die Interstate 5 zu nehmen, sondern über die Landstraße fahren wollte, würde ich – so dachte ich – auch nach Portland kommen. Weit gefehlt.
 Der Columbia River bei Woodland
Der Columbia River bei Woodland
Ich fuhr zunächst südwestlich, kam dann an den Columbia, musste dann einen Bogen nordwärts machen und landete plötzlich wieder bei meinem Motel. Na toll! Also doch die Autobahn.
In Vancouver, nicht das in Kanada, sondern in den USA und zwar im Staate Washington, fuhr ich erneut von der Interstate 5 ab und direkt durch die recht hübsch anzuschauende Innenstadt. Sie war früher viel bedeutender als Portland, da die Hudson Bay Company, die praktisch das gesamte Territorium beherrschte, hier 1824 einen Stützpunkt für den Pelzhandel schuf. Die Mainstreet hat noch einige sehr schöne alte Häuser, die ich mir allerdings nur im Vorüberfahren ansah.
Es tut mir ja leid, doch meine Vorurteile gegenüber Städten konnte ich auch heute nicht loswerden. Sie wurden ein wenig in Vancouver doch so richtig in Portland bestätigt. Nachdem ich erst einige Dead End Straßen – sprich Sackgassen – in Vancouver erlebt hatte, bevor ich die richtige Straße zur Columbia-Brücke erreichte, passierte mir dies auf der anderen Seiten erneut, weil ich nicht wieder auf der Autobahn, sondern am Willamette River entlang fahren wollte. Zuerst landete ich in einem etwas vornehmeren Wohngebiet mit Yachthafen und sah das Schild „Dead End“ und dann wieder in einem Wohngebiet erneut mit einem „Dead End“, bis ich es schließlich aufgab und erneut die Interstate nehmen musste. Da hing mir Portland schon zum Hals heraus und ich fuhr etwas enttäuscht weiter. Eigentlich wollte ich die 99W nehmen, doch ich hätte die 99E nehmen müssen, um gen Süden nach Salem zu fahren. Das war das erste Mal, dass ich mich nicht auf das sonst so klare System mit West und East verlassen konnte. Liegt es an mir?
So blieb mir nichts anderes übrig, als weiter über die sehr belebte 3-spurige Autobahn zu fahren, bis ich sie dann in Aurora, einem kleinen historischen Örtchen mit 60 Einwohnern verließ und mich wieder wohler fühlte. Und siehe da: was sieht mein Auge da und steht zum Verkauf?

 Eine „Tin Lizzi“! Ford Model T von 1923 – das erste Auto vom Fließband – für nur 9.000 $!
Eine „Tin Lizzi“! Ford Model T von 1923 – das erste Auto vom Fließband – für nur 9.000 $!
So was sieht man nicht, wenn man über Autobahnen fährt! (Und wer weiß, was ich noch versäumt habe). Am liebsten hätte ich angehalten und mich erkundigt, was so etwas wohl kosten würde, wenn man es nach Deutschland verschiffen würde. Sicherlich noch mal so viel, schätze ich. (Später, als ich wieder zuhause angekommen war, erzählte mir mein Kumpel Heini, der Spediteur ist, dass das gar nicht so teuer wäre.)
Sie merken schon: ich bin schon wieder viel entspannter. Städte finde ich einfach nervig, wenn man sie mit dem Auto durchfahren muss. Man kann nicht anhalten, um mal ein schönes Foto zu machen, findet nie einen Parkplatz – auch nur für wenige Minuten – und muss teuer dafür bezahlen, obgleich ich ja nur ein oder zwei Fotos machen möchte. Ganz anders auf dem Lande, wie bei dieser alten „Tin-Lizzi“, wie sie liebevoll genannt wurde und wohl auch heute noch wird.
Auch ein solches Blumenfeld kann man nicht von der Autobahn aus oder in der Stadt aufnehmen:  Kornblumen mit anderen blühenden Pflanzen
Kornblumen mit anderen blühenden Pflanzen
Höchstens einen solchen überdimensionierten Straßenkreuzer 
Auch Salem wollte ich vermeiden und so fuhr ich in Kayzers nach rechts ab. Doch wo landete ich? In einer Sackgasse und dann in einem vornehmen Wohnviertel am Williamette River. Da nur in Salem eine Brücke über den Willamette führt, musste ich also doch wieder durch die Stadt, bis ich dann endlich auf der 221 war, die mich nach McMinnville führte.
Der historische Ort McMinnville hat eine nette Hauptstraße mit vielen schönen alten Häusern. 

Doch als ich mir in einem Weinladen mal umsehen wollte, sah ich nirgendwo einen Preis. Da bin ich schnell wieder raus, denn das ist verdächtig! Beim nächsten Laden hatte man schon im Schaufenster einige Preise ausgezeichnet: 36 bis 38 $ die Flasche! Da bin ich gar nicht erst rein. Irgendwie glaubte ich, mich ins Burgund in Frankreich zurück versetzt worden zu sein, wo ich solche Preise schon einmal vor sehr vielen Jahren in Meursault gesehen und vor Schrecken davon gelaufen bin. Solche Preise schmecke ich aus diesen Weinen nicht heraus! Für mich sind sie einfach viel zu teuer. Doch ich bin dafür auch kein Maßstab, denn ich kann durch meine stets leicht verstopfte Nase nicht einmal schmecken oder riechen, wenn der Wein Kork hat.
Soll ich Ihnen dazu mal eine nette Geschichte erzählen? (Sagen Sie nicht „Ach schon wieder!“, denn die Geschichte ist die reinste Wahrheit und nichts als die Wahrheit!) Wenn es Sie nicht interessiert, blättern Sie einfach eine Seite weiter.
Ich war einmal mit drei Damen in New York: Einer Reisejournalistin von der „Welt am Sonntag“, der ersten „Sommelière des Jahres“ aus dem „Gala“ in Aachen und meiner ältesten Tochter Nina. Die Journalistin wusste, dass der berühmte Schauspieler und Regisseur Woody Allen jeden Donnerstag in einer Kneipe mit Freunden Klarinette spielt und da wollten wir hin. Sie schaffte es, einen Tisch für 4 Personen zu bekommen (Journalistin muss man halt sein) und wir fuhren hin. Der Kellner reichte uns die Getränkekarte und unsere Fachfrau, die Sommelière suchte einen Rotwein aus. Damals begannen Chilenische Weine gerade bekannt zu werden und so bestellte sie einen Wein aus Chile.
Wie das nun mal so ist, bekommt immer der Mann das erste Glas zum Probieren. Über diese Macho-Sitte hat sich schon der Bremer Autor Hermann Gutmann mit seinem subtilen Humor in einem seiner Bücher „Hat´s geschmeckt“ köstlich amüsiert und auf die Schippe genommen. Er beschwert sich darin, warum man immer nur so ein Mini-Schlückchen zum Probieren bekommt, von dem nicht einmal die Zungenspitze nass wird. Während seine Frau, die er in seinen Büchern immer „die beste Ehefrau von Welt“ bezeichnet (daher nenne ich ihn auch den Kischon Deutschlands) sich beim ihm darüber beschwert, warum immer er und nicht sie den ersten Schluck probieren darf. Einfach köstlich zu lesen.
Ich bekam also den ersten Schluck zu trinken. Er schmeckte mir und so sagte ich zum Kellner „O. K.“ Dann schenkte er alle vier Gläser voll – die Flasche war danach leer – und wir prosteten uns zu. „Bähhh, der hat ja Kork!“ kam es fast zur gleichen Zeit aus den Mündern meiner drei Damen. Was blieb uns anderes übrig, als eine neue Flasche zu bestellen, die ich dann nicht mehr vorkosten wollte (die Damen wollten auch nicht, dass ich das erneut machte!) Der Kellner hat sich natürlich gefreut, denn er konnte zwei Flaschen berechnen. Seit dieser Zeit lasse ich immer die Dame den Wein probieren. Man wird ja vorsichtiger!
Doch zurück von N. Y. nach Oregon. Das Hotel „Oregon“ in McMinnville hätte mich schon gereizt, dort zu übernachten, denn es ist noch so schön alt und gemütlich. Die Preise scheinen auch zu stimmen, wobei ich nicht weiß, ob die Zimmer mit Bad oder nicht sind, denn sie fangen bei 50 $ die Nacht an, was mir sehr wenig erscheint.
 Interessant fand ich, dass auf dem Schild noch McMenamins steht und der Ort heute McMinnville heißt. Im Restaurant hat man versucht, den alten Stil zu bewahren. Könnte ein richtiges „Romantik Hotel“ sein. Schade, dass es in Amerika keine mehr gibt (doch das hatten wir schon…).
Interessant fand ich, dass auf dem Schild noch McMenamins steht und der Ort heute McMinnville heißt. Im Restaurant hat man versucht, den alten Stil zu bewahren. Könnte ein richtiges „Romantik Hotel“ sein. Schade, dass es in Amerika keine mehr gibt (doch das hatten wir schon…).
Ich fuhr also weiter in Richtung Küste und es schien so, als ob der gestrige Regen den Küstennebel vertrieben hatte, denn der Himmel bot schöne Schäfchenwolken – mit hin und wieder auch dunkleren an.
In Pacific City versuchte ich ein Motel zu buchen, doch in dem ersten war nur noch ein Zimmer mit drei Queensize-beds vorhanden (was soll ich mit drei Betten?) für 160 $ plus Tax und in dem anderen wollte man 299 $ (ich habe mich nicht verhört!) für das Zimmer haben. Natürlich plus Tax. Als ich sagte, das mein Budget das nicht erlauben würde, bot sie mir sofort 100 $ Discount an oder ein Ferienhaus für 160 $ doch plus Reservationfee (wie bitte?) und Reinigungskosten(noch mal: wie bitte?!), was ich auch dankend ablehnte. Man gut so, denn die Küste war sowas von neblig, dass man nicht einmal den Strand sehen konnte. Also fuhr ich weiter.
Ich steuerte einen „Lookout“-Parkplatz an, doch auch da war nichts mit „Lookout“, sondern nur mit Nebel und tropfenden Bäumen und kalt war es auch! Also erneut weiter.
Und dann riss am Ende der Netarts Bay der Himmel plötzlich auf.  Eine kleine Flussmündung mit einem Campingplatz und einem Restaurant machte schon einen guten Eindruck, doch da konnte ich ja nicht übernachten. Nur 100 oder 200 m weiter kam der Ort Netars auf einer kleinen Anhöhe und fast das erste Haus war ein Motel. Also links rein.
Eine kleine Flussmündung mit einem Campingplatz und einem Restaurant machte schon einen guten Eindruck, doch da konnte ich ja nicht übernachten. Nur 100 oder 200 m weiter kam der Ort Netars auf einer kleinen Anhöhe und fast das erste Haus war ein Motel. Also links rein.
 Das „Sea Lion Motel“ in Netarts
Das „Sea Lion Motel“ in Netarts
Das „Office“ war nicht besetzt, doch eine nette Dame, die auch scheinbar gerade angekommen war, sagte mir, dass „the Manager“ gegenüber wohnt und man dort klingeln kann. Machte ich auch und wurde von einem Hundegebell begrüßt. Dann machte eine ältere Dame den oberen Teil der Tür auf – in Norddeutschland nennen wir eine solche Tür „Klön-Tür“, weil man so herrlich klönen kann, ohne die Tür ganz zu öffnen – und sie bat mich hinein. Zwei Hunde und eine Katze beschnupperten mich, ob ich auch willkommen wäre. Sie hatte noch ein Zimmer für 85 $ und ich sagte sofort ja. Sie erbat meine Kreditkarte und notierte die Nummer und meinen Namen in ihrem Guestbook und gab mir dann den Kreditkartenbon zum Unterschreiben.
Mein Room No. 3 erschreckte mich zunächst, denn ich sah nur ein Sofa. `Soll ich da schlafen und noch mein Bett selbst machen?´ dachte ich. Nun ja, was soll´s. Doch als ich mir das Zimmer genauer ansah, gab es noch ein zweites Zimmer und darin stand ein großes Queensizebed. Das ist ja schon sehr angenehm. Und dann noch eine richtige Küche, ein Riesenkühlschrank und was man sonst noch brauchen würde, wenn man mehrere Tage hier Urlaub machen möchte.
Das brachte mich auf die Idee, nicht in ein Restaurant zu gehen, sondern selbst etwas zu kochen. Vielleicht kann ich hier irgendwo Fisch kaufen und dazu einen kühlen Weißwein. Mir lief das Wasser schon im Munde zusammen. Als ich zum Ufer ging, kam ich an einem Laden vorbei, der lebende „Crabs“ anbot. Also ich dann am Strand noch Angler sah, die lebende Krebse gerade aus der Bucht gefangen hatten, stand mein Entschluss so gut wie fest: Krebs!
Auf dem Weg zum Strand sah ich noch etwas:  „Lex Cool Store“.
„Lex Cool Store“.
Vor dem Eingang lagen lauter Pennies, die ich aufhob und sie der Inhaberin – dass musste wohl „Lex“ sein – gab. Sie meinte, dass sie die dahin geworfen hatte, damit die Kids sie finden würden. „That´s a joke“ sagte ich, doch sie verneinte und warf die Münzen, die ich aufgesammelt und ihr gegeben hatte, wieder in den Kies. Etwas verrückt, dachte ich, doch das passt zum ganzen Laden (und wohl auch zur Chefin)!
Und dann sah ich das, was ich eigentlich am Pazifik zu sehen gehofft hatte:
 Blick nach links (dahinten noch Küstennebel)
Blick nach links (dahinten noch Küstennebel)  und Blick nach rechts (breiter Strand und Felsen)!
und Blick nach rechts (breiter Strand und Felsen)!
Da kommt Freude auf und ich ging zunächst bis fast an die Klippen im Meer. Ein heftiger Wind blies mir entgegen, so dass ich sicherheitshalber mein Cap abnahm und ins Hosenbund steckte, damit es nicht wegwehte. Erst dachte ich, da draußen würde ein Boot ankern, doch als ich näher kam, sah ich, dass es ein Wrack war.
Wenn man das sieht, kann man sich einen Eindruck davon machen, wie gefährlich die Küsten vor den Einmündungen von Flüssen sind, denn diese haben große Sandbänke aufgebaut, an denen sich die Wellen schon weit draußen brechen.
Hier kamen mir wieder die ersten Entdecker in den Sinn, die vor diesen Wellen hohen Respekt hatten, denn wie leicht konnte ein Schiff verlorengehen (und damals gab´s noch keine Schlepper, die sie wieder freiziehen konnten, was heute allerdings auch nicht immer gelingt, sonst würde dieses Wrack dort nicht liegen).
In Amerika ist natürlich alles viel größer und schöner. So auch die Muscheln. Erst wollte ich sie mit nach Hause nehmen, doch da sie auf dem Transport leicht zerbrechen, habe ich sie einfach nur fotografiert.
 Die Miesmuschel in der Mitte entspricht etwa der Größe, wie wir sie in Deutschland kennen! Hier ist halt alles größer und schöner!
Die Miesmuschel in der Mitte entspricht etwa der Größe, wie wir sie in Deutschland kennen! Hier ist halt alles größer und schöner!
Und dann kaufte ich mir in dem Laden wo´s die lebenden Crabs gab, einen bereits gekochten Krebs, eine Flasche Weißwein, ein kleines Päckchen Butter und eine dicke Kartoffel:
 Mein Abendessen! Und das ist nicht etwa auf einem Mittelteller fotografiert!
Mein Abendessen! Und das ist nicht etwa auf einem Mittelteller fotografiert!
Am längsten dauerte es, bis die dicke Kartoffel gar war. Da die Sonne kurz vor acht unterging, musste ich vorher noch schnell an den Strand, um den Sonnenuntergang zu fotografieren. So lange konnte das Essen warten.
 Warum sind Sonnenuntergänge eigentlich immer wieder so faszinierend, dass nicht nur, wenn ich am hohen Ufer stand und Fotos machte?
Warum sind Sonnenuntergänge eigentlich immer wieder so faszinierend, dass nicht nur, wenn ich am hohen Ufer stand und Fotos machte?
Ja, so ist der Tag, der mit etwas Stadtfrust begann, doch noch zu einem wunderschönen Ende geworden. Nicht zuletzt auch Dank der Krabbe und der Flasche Weißwein – Chardonnay -, die ich hier beim Schreiben noch genieße. Die Scheren und die Beine sind zwar recht lecker, doch der Rest sieht nicht gerade appetitlich aus. Daher habe ich die „Innereien“ auch nicht gegessen.
Sonntag, den 30. August 2009
Es ist nebelig. Wie in der Wettervorhersage gestern im „Wether-Channel“ vorausgesagt. Wenn ich die Karte richtig gelesen habe, sollte er nur bis Astoria reichen. Also auf und los.
 Doch als ich dann ans Ufer ging, sah das Wetter gar nicht so schlecht aus. Man sieht deutlich schon einen blauen Streifen am Horizont. Auch wie sich die Wellen draußen vor der Sandbank brechen. Und jetzt kommen auch schon die ersten Sonnenstrahlen durch, während ich mir ein paar Crackers mit Käse zum Frühstück gönne.
Doch als ich dann ans Ufer ging, sah das Wetter gar nicht so schlecht aus. Man sieht deutlich schon einen blauen Streifen am Horizont. Auch wie sich die Wellen draußen vor der Sandbank brechen. Und jetzt kommen auch schon die ersten Sonnenstrahlen durch, während ich mir ein paar Crackers mit Käse zum Frühstück gönne.
Ich fuhr nicht über die 101, sondern direkt an der Küste entlang, denn ich wollte ja die typische Küste Oregons und nicht das Inland kennenlernen. Und das tat ich denn auch. Sehen Sie selbst:
 Voller steiler Felsen und Inseln voller Vögel. Dabei müssen die nur 3 Wochen alten Jungen der Common Murres (Trottellummen) vom Nistplatz direkt ins Wasser „springen oder fliegen“, wie es so schön auf den bebilderten Erläuterungen beschrieben wird.
Voller steiler Felsen und Inseln voller Vögel. Dabei müssen die nur 3 Wochen alten Jungen der Common Murres (Trottellummen) vom Nistplatz direkt ins Wasser „springen oder fliegen“, wie es so schön auf den bebilderten Erläuterungen beschrieben wird.
 Das finde ich übrigens sehr gut in den USA, dass überall in den National Parks Erläuterungstafeln stehen, so dass man mehr erfährt, als was man gerade sieht. Sehr lehrreich!
Das finde ich übrigens sehr gut in den USA, dass überall in den National Parks Erläuterungstafeln stehen, so dass man mehr erfährt, als was man gerade sieht. Sehr lehrreich!

 So auch am Cape Meares mit seinem Leuchtturm, der 21 Meilen weit leuchtet.
So auch am Cape Meares mit seinem Leuchtturm, der 21 Meilen weit leuchtet.
Unten am Strand sah ich sie dann endlich: die Baumriesen, die einfach nur so am Strand liegenbleiben.


 Wie kommen die an den Strand? Stimmungsvoll auch die Nebelschwaden, die über der Küste hingen. Irgendwie mystisch.
Wie kommen die an den Strand? Stimmungsvoll auch die Nebelschwaden, die über der Küste hingen. Irgendwie mystisch.
Und die Möwen lassen sich von den Menschen mit Brot füttern, eine wohl etwas falsch verstandene Tierliebe, wie ich finde.

 So dicht bekam ich die Pelikane noch nie vor die Linse. Wenn ich Pelikane sehe, denke ich immer an „Albatros Airlines“ aus dem berühmten Walt Disney Film „Bernhard und Bianca“.
So dicht bekam ich die Pelikane noch nie vor die Linse. Wenn ich Pelikane sehe, denke ich immer an „Albatros Airlines“ aus dem berühmten Walt Disney Film „Bernhard und Bianca“.
 Der Strand wird von einem schmalen Dünenstreifen – wie ein natürlicher Deich – begrenzt und dahinter beginnt der Binnensee, der sich aus dem Trask-River speist.
Der Strand wird von einem schmalen Dünenstreifen – wie ein natürlicher Deich – begrenzt und dahinter beginnt der Binnensee, der sich aus dem Trask-River speist.
Wo diese Flüsse dann schließlich ins Meer fließen, bilden sich immer große Sandbänke, die es den Seefahrern im 18. Jahrhundert auch so schwer machten, den „Großen Fluss“ der Indianer zu finden, weil sie nicht über diese Sandbänke hinwegkamen, ohne ihr Schiff zu gefährden. Daher heißt das nördliche Kap an der Columbia-Mündung auch „Cape Disappointment“. Der Seefahrer John Meares wollte allerdings nicht den Columbia River entdecken, sondern suchte 1788 nach der berühmten Nord-West-Passage, die er hier nicht finden konnte.
Interessant fand ich, dass ich regelmäßig Hinweisschilder für Tsunami Warnungen fand. Ich weiß nicht, ob die schon immer da waren, vermute aber, dass sie spätestens nach dem 26. Dezember 2004 aufgestellt wurden, als der riesige Tsunami – ein Name, den man bis dahin kaum kannte – an den Küsten des Indischen Ozeans 230.000 Menschen dahingerafft hat. „Entering Tsunami Hazard Zone“ weist auf gefährdete Strandabschnitte hin, die von Tsunamiwellen gefährdet sein könnten.
 Wie hier findet man fast an der gesamten Küste historische Hinweisschilder. Captain Robert Gray war der erste Weiße, der 1788 die Tillamook Bucht entdeckte und sie erforschte. Leider nicht ohne einen Kampf mit den Indianern ausgefochten zu haben, der Tote auf beiden Seiten hinterließ.
Wie hier findet man fast an der gesamten Küste historische Hinweisschilder. Captain Robert Gray war der erste Weiße, der 1788 die Tillamook Bucht entdeckte und sie erforschte. Leider nicht ohne einen Kampf mit den Indianern ausgefochten zu haben, der Tote auf beiden Seiten hinterließ.
 Immer wieder wechselte sich Sonnenschein mit Nebel ab, den man nie aus dem Auge verlor.
Immer wieder wechselte sich Sonnenschein mit Nebel ab, den man nie aus dem Auge verlor.
Kurz vor Astoria habe ich mich dann noch einmal mit Lewis und Clark beschäftigen können, die im Fort Clatsop den Winter 1805/06 verbrachten, nachdem sie Mitte November die Mündung des Columbia Rivers entdeckt und somit das Ziel erreicht und ihre Aufgabe erfüllt hatten. Außer Lewis und Clark gehörten noch 30 Soldaten, der Indianer Charbonneau mit seiner Frau Sacaganea und der Diener von Lewis zu der berühmten Expedition. Der erste Nachbau des Forts wurde 1955 gebaut, brannte jedoch 2005 ab, so dass dieser Nachbau noch ziemlich neu ist.

 Der Nachbau des Forts Clatsop, benannt nach den Clatsop Indianern, die hier lebten und die Expedition sehr freundlich aufgenommen haben.
Der Nachbau des Forts Clatsop, benannt nach den Clatsop Indianern, die hier lebten und die Expedition sehr freundlich aufgenommen haben.

 Diese Kopien dokumentieren alle Teilnehmer der Expedition und die Route.
Diese Kopien dokumentieren alle Teilnehmer der Expedition und die Route.
 Danach fuhr ich weiter nach Astoria, benannt nach dem berühmten Johann Jacob Astor aus Walldorf bei Heidelberg, der als Pelzhändler zu großem Reichtum gekommen war und hier lebte. Ihm gehörte u. a. auch das berühmte Hotel Waldorf Astoria in New York. Er ließ eine Säule oberhalb der Stadt zu seinen Ehren errichten, die man schon von weitem sehen kann.
Danach fuhr ich weiter nach Astoria, benannt nach dem berühmten Johann Jacob Astor aus Walldorf bei Heidelberg, der als Pelzhändler zu großem Reichtum gekommen war und hier lebte. Ihm gehörte u. a. auch das berühmte Hotel Waldorf Astoria in New York. Er ließ eine Säule oberhalb der Stadt zu seinen Ehren errichten, die man schon von weitem sehen kann.
 Das Astor-Denkmal und
Das Astor-Denkmal und  die Megler Bridge als Wahrzeichen der Stadt
die Megler Bridge als Wahrzeichen der Stadt
 Astoria hat viel von San Franzisco, so seine steile Lage an einer Bucht und die vielen schönen alten Häuser, insbesondere im Viktorianischen Stil.
Astoria hat viel von San Franzisco, so seine steile Lage an einer Bucht und die vielen schönen alten Häuser, insbesondere im Viktorianischen Stil.
Der Hafen scheint wirtschaftlich keine Bedeutung mehr zu haben, obgleich einige große Schiffe vor Anker im Columbia River lagen, doch die Hafenanlagen sind alle aufgegeben worden und verfallen.
 Verrotte Hafenanlagen
Verrotte Hafenanlagen  direkt neben dem neuen Luxushotel (299 $ die Nacht!)
direkt neben dem neuen Luxushotel (299 $ die Nacht!)
 Das Hotel ist auch den Möwen zu teuer, die sich alle ihr eigenes Ruheplätzchen für die Nacht im zerstörten Hafenbecken ausgesucht haben.
Das Hotel ist auch den Möwen zu teuer, die sich alle ihr eigenes Ruheplätzchen für die Nacht im zerstörten Hafenbecken ausgesucht haben.
Dann ging´s über die schwindelerregende Megler Brücke nach Washington.  Da passen Ozeanriesen durch…
Da passen Ozeanriesen durch… 
 und dann geht’s ziemlich steil bergab bis fast auf Meereshöhe!
und dann geht’s ziemlich steil bergab bis fast auf Meereshöhe!
Jetzt bin ich erneut im Staate Washington und fahre die einsame Küstenstraße – immer noch Highway 101 – gen Norden.
 Ob das wohl stimmt? Oyster Capitol of the World!?
Ob das wohl stimmt? Oyster Capitol of the World!?  Aber diese Auster war wirklich mal riesig!
Aber diese Auster war wirklich mal riesig!
Manchmal hat man wirklich den Eindruck, als ob die Amerikaner nur ihr eigenes Land kennen und was da am Größten, Schönsten und Bedeutendsten ist, wäre „…of the World“! Nun, gönnen wir es ihnen und sollen sie stolz darauf sein.
 Was kommt da für ein Wetter auf?
Was kommt da für ein Wetter auf?
Statt hinter Raymond die 101 direkt nach Aberdeen zu nehmen, wählte ich den Küstenweg über die 105. Doch diese Nebelbank hätte mich warnen sollen: Ich fuhr direkt in den Nebel hinein und kam nicht wieder heraus. Auch in Aberdeen (nicht in Scotland sondern in Washington, USA) war es neblig trüb. Dazu passt eigentlich auch mein billiges (im wahrsten Sinne des Wortes) „Thunderbird Motel“ (54,54 $), das auch schon bessere Tage gesehen hat. Doch was soll`s; Hauptsache ist, dass ich nicht mehr durch den Nebel fahren muss.
 Positiv überrascht war ich vom benachbarten „Dennis“ – auch einer Restaurant-Kette in den USA – wo ich Steak mit Shrimps gegessen habe. Sehr lecker!
Positiv überrascht war ich vom benachbarten „Dennis“ – auch einer Restaurant-Kette in den USA – wo ich Steak mit Shrimps gegessen habe. Sehr lecker!
So, jetzt ist es auch schon wieder 10 Uhr abends und morgen will ich nach Forks, um der Mirja ihre Postkarte schicken zu können. Hoffentlich legt sich der Nebel wieder, bzw. steigt auf. Cross fingers!
Montag, der 31. August 2009
Es ist immer noch Hochnebel. Hoffentlich bleibt das nicht die ganze Zeit, denn dann sieht man überhaupt nichts vom Olympia Berg. Na, wollen mal sehen…
Und nun ist es bereits 9:12 p. m. und ich habe lecker beim Chinesen „Tendy´s Garden“ eine „Crispy Duck“ mit zwei Glas Rotwein getrunken. Hätte ich den heutigen Tagesbericht vorher abgefasst, wäre er wohl etwas anders ausgefallen. Doch zurück zu heute Morgen.
Immer noch Nebel. Nicht nur in Aberdeen, WA. USA. So wie man in Aberdeen (Scotland) geizig mit dem Geldausgeben ist, ist man in Aberdeen (Washington, USA) offenbar geizig mit der Sonne.
 Aberdeen. Sieht so richtig einladend aus, oder?
Aberdeen. Sieht so richtig einladend aus, oder?
Schnell raus hier und daher habe ich – weil es auch in meinem Motel keinen „early morning tea“ gab – auch nicht mehr gefrühstückt. Soll man wohl nicht machen, denn das rächte sich (wenn ich abergläubisch bin, doch davon später, damit Sie etwas mehr Spannung bekommen).
Die Küste von Washington ist – nach meiner Ansicht – nicht so interessant wie die in Oregon, obgleich es auch hier tolle Abschnitte gibt.
 Die Möwen warten auch auf besseres Wetter
Die Möwen warten auch auf besseres Wetter  und die sieht richtig traurig aus, verständlich!
und die sieht richtig traurig aus, verständlich!
 Die trübe Aussicht bleibt, ob über Land
Die trübe Aussicht bleibt, ob über Land  oder am Lake Quinault.
oder am Lake Quinault.
Doch am Lake Quinault gibt es ein tolles Lodge, in dem schon Roosevelt war, und wo der war, will ich auch gewesen sein: Im „Roosevelt Room“ des „Lake Quinault Lodge“! Gehen Sie bitte nicht auf deren Internetseite, denn da scheint die Sonne. Schauen Sie sich lieber meine Bilder an, denn so soll es hier an 375 (!) Tagen im Jahr sein (armer Roosevelt!):
 Ein Besuch im Jahr 1837 hier im Lodge soll in inspiriert haben, den Olympia Nationalpark zu schaffen.
Ein Besuch im Jahr 1837 hier im Lodge soll in inspiriert haben, den Olympia Nationalpark zu schaffen.


 Sehr gemütlich das Lake Quinault Lodge, da mag man bei so trübem Wetter am liebsten im Hotel und auf dem Zimmer bleiben…
Sehr gemütlich das Lake Quinault Lodge, da mag man bei so trübem Wetter am liebsten im Hotel und auf dem Zimmer bleiben…
Ich will ja nicht wieder davon anfangen, doch man zwingt mich geradezu dazu: die Straßensperren. Es werden überall Straßen ausgebessert, wie auch in Oregon, um die Arbeiter mit staatlichen Mitteln „back to work“ zu bringen. Das ist auch ganz o. k. so, wenn man sich ansieht, wie viele Menschen es braucht, um eine kleine oder auch etwas größere Baustelle abzusichern:
 Verkehrsregelung in den USA. Und dann kommt dieses Auto mit der Aufschrift „Follow me“ (Man ist nicht auf einem Flughafen, sondern auf einer Straße!
Verkehrsregelung in den USA. Und dann kommt dieses Auto mit der Aufschrift „Follow me“ (Man ist nicht auf einem Flughafen, sondern auf einer Straße!
Es sind auf jeden Fall zwei Menschen nötig – ich nenne sie mal „Stop“- and „Slow“-Arbeiter oder Arbeiterinnen – (auf jeder Seite eine Person), die den „most responsibel job of the world“ haben, denn sie verhindern ja Tote und Verletzte. Da sie bei dieser verantwortungsvollen Aufgabe nicht von morgens bis abends tätig sein können – halten Sie mal mehrer Stunden dieses Ding in der Hand, der Arm würde Ihnen abfallen – sind mindestens drei Schichten erforderlich, d. h. 6 Leute.
 Dann kommt – wie auf dem Flughafen (habe ich schon beschrieben), ein anderes Auto mit der Aufschrift: „Follow me“ (nicht auf dem Flughafen, sondern auf der Straße!)
Dann kommt – wie auf dem Flughafen (habe ich schon beschrieben), ein anderes Auto mit der Aufschrift: „Follow me“ (nicht auf dem Flughafen, sondern auf der Straße!)
Diesen Job kann man auch nicht 24 Stunden am Tag machen, also braucht man mindestens 3 Schichten = 3 Personen. Somit wären wir bei 9 Mitarbeitern. Da eine/r immer krank oder in Urlaub ist, braucht man als gute/r Vorarbeiter/in, mindestens 10 Leute unter sich. Und da man ja selbst auch nicht ewig arbeiten und die wahnsinnige Verantwortung für Lebende und Tote übernehmen kann, braucht es zumindest einen Stellvertreter und mindestens 3 – 4 Assistenten. Also sind wir bei 15 – 16 Leuten in Lohn und Brot! Und da die Baustelle höchstens 100 bis 200 m einspurig ist, muss man sie mindestens 2 – 3 Meilen vorher und nachher absperren, damit die Leute sich auf die Engstelle einstellen können. Schon genial gedacht! In Deutschland kauft man zwei Ampeln und entlässt die Mitarbeiter/Innen.
So wartet man als Autofahrer bis zu 15 oder 20 Minuten, was auch gut für die Nerven sein soll…
Und wenn man diesen Engpass dann überwunden hat, kommt das:  Das ist kein Nebel oder Staub, sondern Gravel! (Erzählen Sie das mal dem Autovermieter, der behauptet garantiert, dass sie auf verbotenen „unpaved roads“ gefahren sind!)
Das ist kein Nebel oder Staub, sondern Gravel! (Erzählen Sie das mal dem Autovermieter, der behauptet garantiert, dass sie auf verbotenen „unpaved roads“ gefahren sind!)
Doch wenden wir uns wieder schöneren Dingen zu.
 Die Küste – wenn man mal an sie rankommt – ist noch wilder und unberührter als in Oregon. Und durch den Nebel (ich weiß nicht, ob er hier ständig vorhanden ist), wirkt alles noch viel dramatischer: Hier kommt man nur über einen kleinen Pfad und nur über dicke Baumleichen an den Strand.
Die Küste – wenn man mal an sie rankommt – ist noch wilder und unberührter als in Oregon. Und durch den Nebel (ich weiß nicht, ob er hier ständig vorhanden ist), wirkt alles noch viel dramatischer: Hier kommt man nur über einen kleinen Pfad und nur über dicke Baumleichen an den Strand.
 Man kann nicht unterscheiden, was Nebel und was Wellengischt ist.
Man kann nicht unterscheiden, was Nebel und was Wellengischt ist. 
 Aufpassen muss man schon.
Aufpassen muss man schon.

 Doch was man zu sehen bekommt, ist schon gewaltig und beeindruckend, zumindest für mich.
Doch was man zu sehen bekommt, ist schon gewaltig und beeindruckend, zumindest für mich.
Das Bild habe ich zwar schon einige Meilen vorher aufgenommen, doch wie Sie ja schon wissen, hatte ich in Forks eine Aufgabe zu erledigen: eine Postkarte an meine Tochter Mirja zu schreiben.
 Denn hier spielen sich die z. Zt. auf allen Bestsellerlisten stehenden Geschichten über „Twilight“ & Co. – bei uns mehr als „Bis(s)… – in den Büchern von Stephenie Meyer ab. Warum gerade in Forks kann ich nicht sagen, vielleicht, weil es hier dauernd nebelig ist und die Gegend daher etwas mystisch wirkt oder man ein bis(s)chen verrückt sein muss, um sich hier zu verlieben oder es das Einzige ist, was man hier tun kann. Wer weiß? Vielleicht nur Stephenie Meyer. Bestimmt hat ein Reporter oder Talk Master sie schon danach gefragt.
Denn hier spielen sich die z. Zt. auf allen Bestsellerlisten stehenden Geschichten über „Twilight“ & Co. – bei uns mehr als „Bis(s)… – in den Büchern von Stephenie Meyer ab. Warum gerade in Forks kann ich nicht sagen, vielleicht, weil es hier dauernd nebelig ist und die Gegend daher etwas mystisch wirkt oder man ein bis(s)chen verrückt sein muss, um sich hier zu verlieben oder es das Einzige ist, was man hier tun kann. Wer weiß? Vielleicht nur Stephenie Meyer. Bestimmt hat ein Reporter oder Talk Master sie schon danach gefragt.
Doch auf jeden Fall sollten Sie hier eines vermeiden: Etwas zu kaufen und versuchen, es mit einem Euro-Travellerscheck zu bezahlen. Sie werden folgendes erleben (und daher erzähle ich die Geschichte erst, nachdem ich mich beruhigt und am Abend gegessen und etwas Rotwein getrunken habe!):
Ich hatte gar nicht gewusst, dass meine alten Travellerschecks, die ich von früheren Reise übrig behalten und auf diese Reise mitgenommen hatte, z. T. in Euro´s ausgestellt waren. Da ich nur noch 10 $ Cash bei mir hatte, dachte ich, da zahlst du am besten mit einem Travellerscheck und lässt dir den Rest in bar auszahlen, wie ich es schon am ersten Abend in San Franzisco gemacht hatte. Doch das war ein $-Scheck gewesen!
Ich unterschrieb den Trallerscheck und die Verkäuferin zeichnete ihn gegen. Doch als sie ihn genauer betrachtete, stellt sie fest, dass es ein €-Travellerscheck war. Da musste sie erst ihre Kollegin anrufen, die dann sagte, dass das nicht geht. Doch sie tröstete mich, denn nicht wenige Blocks entfernt gäbe es eine Filiale der Bank of America, die würden den Scheck ohne Probleme einlösen. Nun, ich bezahlte das, was ich gekauft hatte, mit meiner Kreditkarte und fuhr zur „Bank of America“.
Ich legte der Dame am Schalter den bereits unterzeichneten Travellerscheck vor und erzählte die Story, warum er schon unterschrieben war. Sie blickte etwas erstaunt und wenn ich es übersetzen könnte, was sie dachte, würde ich wohl sagen: „Tscha, mein Lieber, das sieht gar nicht gut aus. Da muss ich erst mal meine Kollegin fragen.“ Und als sie das getan hatte, schüttelte sie nur mit dem Kopf. „We cannot accept Euro-Travellars-Checks!“. Wieso denn das nicht, das ist doch ein internationales Zahlungsmittel? meinte ich. Ja, sie fand das System auch ein bis(s)chen „stupid“. Ich hoffe, dass sie das so gesagt hat, denn ich will niemanden beleidigen oder ihr was unterschieben, was sie nicht gesagt hat, doch sie war anscheinend auch nicht von dem System überzeugt.
Sie war jedoch so nett und beschrieb mir ausführlich, dass es in Port Angeles – auf direktem Wege immerhin 55 Meilen weiter nördlich und ich wollte direkt an der Küste entlang fahren, also noch mal 20 Meilen mehr – eine Wechselstube gibt, die direkt am Hafen gegenüber dem „Dairy Queen“ wäre. Es täte ihr zwar sehr leid, doch anders können sie mir nicht helfen. Arme Frau, dachte ich, arbeitet für die größte Bank in den USA, die Methoden hat, die auch sie nicht einsehen, geschweigen denn, verstehen kann. Die Bank verkauft zwar Schrottpapiere in riesigen Mengen und verursacht damit (zusammen mit anderen Banken) den größten globalen Finanz- und Wirtschaftscrash aller Zeiten, aber einen €-Travellercheck können sie nicht einlösen! Tolle Bank!!!
Also fuhr ich weiter, ohne mir weiter große Gedanken zu machen, denn eine Lösung wäre in Port Angeles ja zu erwarten. Dachte ich.
Kurze Zeit später musste ich an der Abzweigung zur 113 unbedingt anhalten, um diese herrliche Werbung zu fotografieren:
 Thats America! Bigger as big can be! “The World´s biggest Hamburger”? Vielleicht.
Thats America! Bigger as big can be! “The World´s biggest Hamburger”? Vielleicht.
Inzwischen – schon auf der 113 zur Küste – dachte ich, die Sonne werde ich heute wohl nicht wiedersehen, doch da kam sie plötzlich durch. Es war wie eine Erlösung und als wäre man aus einem dunklen Taum aufgewacht: Die Sonne lachte!
 Sowohl über den Bergen mit einem See davor, als auch über dem Wasser, der „Strait auf Juan de Fuca“ noch letzte Nebelschwaden. Da lacht das Herz und auch der Mensch plötzlich wieder.
Sowohl über den Bergen mit einem See davor, als auch über dem Wasser, der „Strait auf Juan de Fuca“ noch letzte Nebelschwaden. Da lacht das Herz und auch der Mensch plötzlich wieder.
In Port Angeles angekommen fuhr ich direkt an den Hafen, fand auch das „Dairy Queen“ sofort und ging – wie beschrieben – genau gegenüber in die Tourist Information, weil ich glaubte, das wäre auch die Wechselstube. Doch dem war nicht so. Die nette Dame am Counter schickte mich in das Gebäude nebenan, wo auf der Rückseite, direkt neben der Fähre nach Victoria Island, ein Wechsebüro wäre. Also ging ich dorthin.
„May I help You“ ist ja immer die erste Frage, wo man auch immer ist, und ich sagte dem Herren am Schalter, wie ich hierher geschickt worden bin. Er sagte: „Just a moment, plaese“ und telefonierte mit jemandem. Ich hörte schon am Telefon ein „No“ und war gespannt, was er mir sagen würde. Nein, Euro-Travellerschecks nehme man nicht. Wenn es ein „Bill“ wäre, dann schon. Ja aber, ich kann bei ihm ja nichts kaufen, außer Geld, wieso würde er dann nur eine „Bill“ – sprich eine Rechnung – akzeptieren? (Später kam mir in den Sinn, dass man in Amerika auch die Banknote als „Bill“ bezeichnet, doch das war später). Zornig wie ich inzwischen geworden war – sind wir hier in Uganda oder in Amerika – ging ich unverrichteter Dinge wieder zum Auto zurück. Und da kam es mir, dass er ja vielleicht Bill = Geldschein gemeint hatte. Ich holte also zwei 50 Euro Banknoten aus meinem Gepäck (zum Glück hatte ich genügend Euros mitgenommen) und ging erneut ins Wechselbüro.
Inwischen war eine ältere Dame im Büro und als ich den Herrn fragte „You take that?“ und die zwei 50 Euroscheine auf den Tresen legte, sagte er „Yes“. Da mischte sich die Dame ein, die wohl die Chefin und die Person war, mit der er vorher am Telefon gesprochen hatte, und müllte mich mit viel Geschwafel und Belehrungen voll. Sie wären ja eine „Geld“-Umtauschstelle und keine „Travellerschecks“-Umtauschstelle, wie ich ja draußen lesen könnte. Euro-Travellerschekcs würde hier niemand abkaufen, als ob ich wüsste, wie das amerikanische Banken- und Geldsystem funktioniern würde. Da ich schon ziemlich aufgeregt und zornig war und wusste, wenn das so weiter geht, würde mein Adrenalinspiegel weiter steigen und ich wie das berühmte HB-Männchen irgendwann an die Decke gehen oder mich in der Wortwahl vergreifen würde, sagte ich, dass wir die Diskussion lieber beenden sollten, da ich mich nur weiter aufregen würde. Das übergang sie zwar und laberte weiter, bis ich meinte, ich komme mir vor wie Lewis und Clark, die vor über 200 Jahren den Weg nach Westen entdeckt hatten – und sicherlich bei den Indianern auch keinen Travellerscheck einlösen konnten – so dass sie endlich ihren Mitarbeiter anwies, im PC nachzuschauen, welchen Wechselkurs man mir geben würde. 129 $ sagt er mir. Da ich wusste, dass der Euro bei über 1,40 $ lag, sagte ich „You want to charge 11 Dollars fee?!“ doch dann sagte ich „O.k., o.k., o.k.“, um dem Ärger endlich ein Ende zu bereiten, doch das half nicht. Sie meinte zu ihrem Mitarbeiter, er solle mir 140 $ ausbezahlen und dann später noch mir ihr sprechen. Er gab mir die 140 $, ich sagte kurz „Thank you“ und verließ das Büro.
Sie können sich nicht vorstellen, wie oft und wie tief ich ein- und ausatmen musste, um diesen Ärger hinter mich zu bringen. Da haben die Banken in den USA die Leute abgezockt bis zum geht-nicht-mehr. Das gesamte Weltwirtschaftssystem kaputt gemacht, was zu eine riesigen Weltwirtschaftskrise geführt hat, sind vom Staat massiv unterstützt, wenn nicht sogar übernommen worden, um nicht wie bei Lehman Brothers in Konkurs zu gehen zu müssen und dann sind sie noch nicht einmal in der Lage, einen 100 €-Travellerscheck einzulösen. In Deutschland hätte ich gesagt: „Armes Deutschland“, doch in den USA muss man etwas vorsichtiger sein, um nicht evtl. noch als Nazi angesehen zu werden. Sie sehen: ich war ganz schön auf Brass, wie man in Norddeutschland sagen würde!
Doch – und da ist die Natur wieder „Schuld“ – es war wunderbarer Sonnenschein und ich überlegte, ob ich heute Nachmittag noch auf den Mt. Olympia fahren sollte oder erst Morgen früh. Doch da es erst gegen 4 Uhr war, fuhr ich hoch in den „Olympic National Park“. Eintritt 15 $, die ich ohne frisches Geld wohl kaum hätte bezahlen können, obgleich die wohl auch Kreditkarten nehmen. Und das hat mich wieder zurück auf den glücklichen Boden gebracht. Denn sehen Sie selbst:

 Schon herrliche Aussichtenbei der Auffahrt in den Olympic National Park.
Schon herrliche Aussichtenbei der Auffahrt in den Olympic National Park.
Und dann erst ganz oben: 

 Was sind die menschlichen Sorgen doch so klein, wenn man sowas sehen und erleben kann!
Was sind die menschlichen Sorgen doch so klein, wenn man sowas sehen und erleben kann!


 Doch nicht nur die „großen Dinge, sondern auch die kleinen erfreuen das Herz! Da war mein Seelenheil wieder in Ordnung und ich erfreute mich des Lebens!
Doch nicht nur die „großen Dinge, sondern auch die kleinen erfreuen das Herz! Da war mein Seelenheil wieder in Ordnung und ich erfreute mich des Lebens!
Ich wanderte den Trail bergauf, genoß die herrlichen Aussichten und studierte die sehr guten Informationstafeln, die, wie in allen Nationalparks, sehr gute Erläuterungen vermitteln.
 Blick nach Norden…
Blick nach Norden…  …und nach Süden vom Olympic National Park
…und nach Süden vom Olympic National Park
 Auf der Informationsstelle zeigte ich einem Ranger das Bild von dem Vogel, den ich fotografiert hatte und fragte ihn, was das für ein Vogel wäre. Er war sich nicht ganz sicher, weil das Display auf meinem Fotoapparat trotz Zooming wohl zu klein war, um Genaues erkennen zu können. Er meinte, dass es ein Gray Jay sein könnte. Er fragte eine Kollegin, die sich ein Buch holte und vergleichen wollte, doch auch nicht so genau sagen konnte, was das für ein Vogel wäre, da die Abbildungen doch etwas anders aussahen, als auf meinem Foto. Zum Schluß standen 4 oder 5 Ranger um mich herum, doch was es nun ganz genau war, haben wir nicht rausgekriegt. Da habe ich wohl eine neue Vogelart entdeckt und kann mich mit Alexander von Humboldt auf eine Stufe stellen! (Einer spinnt immer…)
Auf der Informationsstelle zeigte ich einem Ranger das Bild von dem Vogel, den ich fotografiert hatte und fragte ihn, was das für ein Vogel wäre. Er war sich nicht ganz sicher, weil das Display auf meinem Fotoapparat trotz Zooming wohl zu klein war, um Genaues erkennen zu können. Er meinte, dass es ein Gray Jay sein könnte. Er fragte eine Kollegin, die sich ein Buch holte und vergleichen wollte, doch auch nicht so genau sagen konnte, was das für ein Vogel wäre, da die Abbildungen doch etwas anders aussahen, als auf meinem Foto. Zum Schluß standen 4 oder 5 Ranger um mich herum, doch was es nun ganz genau war, haben wir nicht rausgekriegt. Da habe ich wohl eine neue Vogelart entdeckt und kann mich mit Alexander von Humboldt auf eine Stufe stellen! (Einer spinnt immer…)
 Auf der Rückfahrt sah ich dann noch diese Reh-Famlie mit einem „Bamby“ direkt am Straßenrand, die überhaupt nicht scheu war, so daß ich bis auf wenige Meter herangehen und fotografierne konnte. Auch das tut gut!
Auf der Rückfahrt sah ich dann noch diese Reh-Famlie mit einem „Bamby“ direkt am Straßenrand, die überhaupt nicht scheu war, so daß ich bis auf wenige Meter herangehen und fotografierne konnte. Auch das tut gut!
 Am Abend habe ich beim Chinesen „Tendy´s Garden“ noch eine leckere
Am Abend habe ich beim Chinesen „Tendy´s Garden“ noch eine leckere  „Chrispy Duck“ mit zwei Gläsern Merlot aus Washington genossen. Jetzt geht es mir wieder sehr viel besser!
„Chrispy Duck“ mit zwei Gläsern Merlot aus Washington genossen. Jetzt geht es mir wieder sehr viel besser!
Während ich so auf das Essen wartete, beobachtete ich wie üblich, was sich so um mich herum tat. Mir gegenüber saß ein Pärchen so Mitte 30 schätze ich mal. Sie sah ich nur von hinten – nicht ganz schlank – und er war eher so ein einigermaßen gut aussehender Machotyp. Er blickte immer woanders hin aber nie seine Partnerin an. Die Konversation war minus 6 – würde ich mal sagen – und man hatte wirklich das Gefühl, dass die sich überhaupt nichts mehr zu sagen haben und sich gegenseitig totschweigen würden. Wie grausam, dachte ich. Da kann auch im Bett nicht mehr viel gut gemacht werden. Diese Beziehung dürfte wohl am Ende sein…
Da bin ich wirklich froh, alleine reisen zu können und die Zeit des sich Totschweigens hinter mir zu haben. Ich kann während dessen über Gott und die Welt nachdenken und das tat ich denn auch. Da sitze ich bei einem Chinesen zum Essen, wohne in einem Motel, das von einer Koreanischen Familie geführt wird und denke, dass ich noch viel zu wenig Menschen und Rassen auf dieser Welt kennen- und schätzen gelernt habe.
Da denke ich auch an den herrlichen Spruch eines weisen Mannes: „Wer wenig weiß, glaubt alles zu wissen. Wer viel weiß, weiß, wie wenig er weiß.“ Wer es war, weiß ich nicht, doch es könnte von Sokrates abgewandelt worden sein, der gesagt haben soll: „Ich weiß, dass ich nichts weiß?“ Ich möchte noch so vieles erleben und kennenlernen und daher reise ich auch so gerne, denn „Reisen bildet“ ja bekanntlich!
Un da es jetzt schon wieder 20 nach 11 ist, sollte ich wohl besser ins Bett gehen. Mal sehen, was ich diese Nacht für schlimme oder wilde Träume habe, wie es die ganzen letzten Nächte schon der Fall war. Ein Fall für Freud?
Dienstag, der 1. September 2009
Mein erster Blick nach dem Aufstehen geht immer nach draußen: Es ist neblig! Man gut, dass ich gestern nachmittag noch hoch zum Olympia Mountain gefahren bin. Heute hätte ich mich mehr als geärgert. Doch wer weiß, vielleicht ist der Nebel nicht so hoch. Ich werde es einfach noch mal probieren.
Interessant war eine Email, die ich heute morgen von Frau Lawson, geb. Diekmann aus Tomales, CA. bekommen hatte. Auch sie hatte fleißig recherchiert und dabei herausbekommen, dass ihre und wohl auch meine Vorfahren aus dem Schaumburg-Lippe Gebiet stammen müssen. Das kann ja noch interessant werden, denn das Internet bietet da heutzutage Möglichkeiten, die man früher nur in alten Kirchenbüchern in den Sakristeinen fand, wo ich mal meine Vorfahren recherchiert habe. Bis ins 17. Jahrhundert war ich damals gekommen, doch die Unterlagen sind alle weg (bin wohl zu oft umgezogen…). Da werde ich den Kontakt zu Mrs. Lawson noch ein wenig aufrecht erhalten, wenn ich wieder zuhause bin.
Doch jetzt schnell unter die Dusche, etwas frühstücken und dann mal sehen, ob über den Wolken die Freiheit grenzenlos ist und ich zum Olymp aufsehen kann!
Ich bin doch nicht erneut hinaufgefahren. Als sich der Nebel lichtete, sah man hohe Wolken, die auch auf den Bergen keine Sonne erwarten ließen. Also fuhr ich weiter, denn im Osten kamen blaue Streifen Himmel zum Vorschein.
 Im Osten geht die Sonne auf (dachte ich), doch dann kamen die ersten Regentropfen.
Im Osten geht die Sonne auf (dachte ich), doch dann kamen die ersten Regentropfen.
 Unterwegs machte ich an einer interessanten Tankstelle mit nachgemachten Totempfählen halt. An dieser Tankstelle meinte die Kassiererin, das man dringend Regen gebrauchen könnte (und das auf der als regenreich bekannten Olympia Halbinsel!).
Unterwegs machte ich an einer interessanten Tankstelle mit nachgemachten Totempfählen halt. An dieser Tankstelle meinte die Kassiererin, das man dringend Regen gebrauchen könnte (und das auf der als regenreich bekannten Olympia Halbinsel!).
Da ich meinen ursprünglichen Plan aufgegeben hatte, rund um den Pudget Sound nach Süden und dann über Seattle nach Norden zu fahren – das wären mindestens 200 Meilen Umweg auf mehrspurigen Highways gewesen und alles nur durch Ansammlungen von Städten – bin ich über Port Townsend mit der Fähre zum Whidby-Island gefahren und das war sehr schön. Wenn das Wetter noch etwas mehr mitgespielt hätte, wäre es sogar eine phantastische Fahrt gewesen, doch auch hier lag der Nebel noch ziemlich tief. Dazu später mehr.
In Port Thownsend hatte ich natürlich keine Fähre reserviert, doch das war überhaupt kein Problem. Die Überfahrt würde in einer knappen Stunde erfolgen und kostet für mich als „Senior citizen“ nur 8,85 $. Also schlenderte ich noch etwas durch Port Townsend und war zum einen überrascht, wie viele nette Läden sich in der Altstadt befinden, doch zum anderen auch enttäuscht, in welchem verfallen Zustand sich die meisten historischen Gebäude befinden. Da kam wieder der Romantiker in mir durch und ich fragte mich, wieso die Häuser alle in einem solch erbärmlichen Zustand sind. Der Hafen muss wohl früher eine wesentlich größere Bedeutung gehabt haben als heute. Hier nur einige Beispiele:



 Schöne alte Gebäude in Port Thownsend, deren schlechter Zustand auf diesen Fotos kaum zu erkennen ist. Was muss nur geschehen, um diese schöne Altstadt wieder zu altem Glanz zu verhelfen?
Schöne alte Gebäude in Port Thownsend, deren schlechter Zustand auf diesen Fotos kaum zu erkennen ist. Was muss nur geschehen, um diese schöne Altstadt wieder zu altem Glanz zu verhelfen? 

In dem APA-Reiseführer hatte ich gelesen, dass Port Townsend im Schatten der Berge liegend nur sehr wenig Regen bekommt. Das konnte ich nicht nachvollziehen, denn während es an der Westküste den ganzen Tag nur neblig war – teilweise mit Nebelnässen – hatte ich auch hier regnerisches Wetter.
Schade, dass auch auf dem Wasser nur trübes Wetter herrschte, denn der Teil des Pudget Sounds, den wir in ca. ½ Stunde durchquerten, hat es verdient, im strahlenden Sonnenschein erlebt zu werden. Es gab kleine Seevögel, die ich nicht kannte und eine andere Art von Haubentauchern, Robben und kleine Wale tauchten ab, als das Schiff vorbei fuhr.
 Nur ein U-Boot sahen wir noch, (doch es hat uns passieren lassen)
Nur ein U-Boot sahen wir noch, (doch es hat uns passieren lassen) 
Auf zu neuen Ufern,  dachte ich, als wir den kleinen Hafen der Insel Whidbey erreichten, wenngleich auch hier die trübe Stimmung keine Empfangsfreude aufkommen ließ.
dachte ich, als wir den kleinen Hafen der Insel Whidbey erreichten, wenngleich auch hier die trübe Stimmung keine Empfangsfreude aufkommen ließ.
Der nächste kleine Ort war da schon interessanter: Copeville.
 Copewille hat nette kleine Geschäfte und Restaurants direkt am Wasser, doch bei trübem Wetter kommt die Schönheit gar nicht so richtig zur Geltung.
Copewille hat nette kleine Geschäfte und Restaurants direkt am Wasser, doch bei trübem Wetter kommt die Schönheit gar nicht so richtig zur Geltung.
Der größte Ort auf der Insel ist Oak Harbour, der sicherlich nicht zuletzt durch die nahegelegene Navel Station Aufschwund erhalten hat. Und – Sie mögen es glauben oder nicht – ich machte zum ersten Mal auf dieser Reise an einem „Burger King“ Halt und kaufte mir einen Cheeseburger und einen Erdbeershake. Einmal muss man sich das mindestens gönnen, wenn man schon in den USA ist.
 Witzig auch dieses Motel, das sich sein unnachahmliches USP (unique selling proposition) also sein Alleinstellungsmerkmal, wie ich es im Marketing gelernt habe, geschaffen hat. So ein Motel gibt es (glaube ich) nicht einmal in Holland!
Witzig auch dieses Motel, das sich sein unnachahmliches USP (unique selling proposition) also sein Alleinstellungsmerkmal, wie ich es im Marketing gelernt habe, geschaffen hat. So ein Motel gibt es (glaube ich) nicht einmal in Holland!
Zurück zur Geschichte: Wird man an der Brücke über den „Deception Pass“ – der Schwindel- oder Täuschung-Durchfahrt – geführt, denn Captain Vancouvers Leute glaubten 1792, eine Durchfahrt gefunden zu haben, doch sie entdeckten nur eine Insel, die dann nach dem Captain Whidbey benannt worden ist.


 Hier merkt man Ebbe und Flut enorm stark durch die schmale Rinne des „Deception-Pass“ strömen.
Hier merkt man Ebbe und Flut enorm stark durch die schmale Rinne des „Deception-Pass“ strömen.
Eine große Brücke brachte mich wieder auf´s Festland und als ich den Freeway 5 überquert hatte, ging es jetzt immer weiter über den Highway 20 in die North Cascade Mountains am Skagit River entlang.
 Und schon wieder eine „Stop and Slow Baustelle.
Und schon wieder eine „Stop and Slow Baustelle.
Die ersten schneebedeckten Berge ließen sich blicken, so auch der Mt. Baker, doch so richtige Freude kam nicht auf, denn die Witterung ließ keine schöneren Einblicke zu.
Ich versuchte, ein B & B zu finden, das sich Ingrid Meyer, eine frühere Geschäftspartnerin, vor mindestens 25 Jahren in diesem Tal gebaut hatte, nachdem sie unsere Reservierungsstelle für Romantik Hotels an ihren Sohn übergeben hatte. Ich fragte sogar an einem Häuschen in einem National Park nach Ingrid Meyer, doch eine solche Person kannte man nicht. Nur ein B & B, das sich in einer ehemaligen Farm befindet, kannte man. Nun, hat nicht sollen sein. Wenn man ein schlechtes Gedächtnis hat, kann so was schon mal passieren.
Herrliche Naturschauspiele begleiteten mich auf dem Weg nach Osten:
 Hier sieht man deutlich die früheren Sandschichten eines Urmeeres…
Hier sieht man deutlich die früheren Sandschichten eines Urmeeres…

 …und diese Bäume haben offenbar schon ihren Wintermantel angezogen.
…und diese Bäume haben offenbar schon ihren Wintermantel angezogen.
 Woodcarving habe ich in Washington soviel gefunden, wie nirgendwo anders an der Westküste von Oregon oder Kalifornien.
Woodcarving habe ich in Washington soviel gefunden, wie nirgendwo anders an der Westküste von Oregon oder Kalifornien.
Doch irgendwie war ich heute früher müde als sonst und so suchte ich mir in dem kleinen Ort Marblemountain dieses „Buffalo Run Inn“ aus, das gleich nebenan auch ein Restaurant hatte.
 Das „Buffalo Run Inn“
Das „Buffalo Run Inn“  Mein Abendmahl: Shrimps and Chips.
Mein Abendmahl: Shrimps and Chips.
Dienstag, den 2. September 2009
Aus der Sicht eines Hoteliers ist es schon interessant, wie die Inns und Motels in den USA betrieben werden.
 Sie haben fast alle eine Kaffeemaschine im Zimmer mit Kaffee, Kaffeeweißer, Zucker und Süßstoff, manchmal auch mit Teebeuteln.
Sie haben fast alle eine Kaffeemaschine im Zimmer mit Kaffee, Kaffeeweißer, Zucker und Süßstoff, manchmal auch mit Teebeuteln.
Darüber hinaus bieten sie – nicht alle – ein sogenanntes „Continental breakfast“ an, das ausschließlich in Selbstbedienung funktioniert.  Meistens gibt es dafür gar keinen Frühstücksraum, sondern nur die Lobby mit einigen Tischen. Da findet man in der Lobby ein Kühlschrank, der ist tagsüber mit einer Fahrradkette verschlossen (schade, dass ich das gestern Abend nicht fotografiert habe, denn heute Morgen ist die Kette natürlich weg). Weiter stehen dann eine Kaffeemaschine, Teewasser, Kaffee, Tee meist aus Tüten zum Selbstzubereiten bereit. Außerdem vielleicht ein Automat für Säfte sowie Toastbrot, Bagels und verschiedene Kuchensorten. Manchmal auch nur süßes Zeug. Alles muss der Gast selbst machen und auch wieder abräumen. Es ist niemand von den Mitarbeitern dabei, d. h. man spart Mitarbeiterkosten für das Frühstück gänzlich ein.
Meistens gibt es dafür gar keinen Frühstücksraum, sondern nur die Lobby mit einigen Tischen. Da findet man in der Lobby ein Kühlschrank, der ist tagsüber mit einer Fahrradkette verschlossen (schade, dass ich das gestern Abend nicht fotografiert habe, denn heute Morgen ist die Kette natürlich weg). Weiter stehen dann eine Kaffeemaschine, Teewasser, Kaffee, Tee meist aus Tüten zum Selbstzubereiten bereit. Außerdem vielleicht ein Automat für Säfte sowie Toastbrot, Bagels und verschiedene Kuchensorten. Manchmal auch nur süßes Zeug. Alles muss der Gast selbst machen und auch wieder abräumen. Es ist niemand von den Mitarbeitern dabei, d. h. man spart Mitarbeiterkosten für das Frühstück gänzlich ein.
Doch es steht dort auch ein Hinweisschild, dass der Gast auf keinen Fall ein Lunchpaket oder sonst irgend etwas mitnehmen darf, denn „andere Gäste möchten ja auch frühstücken!“ Ja, so kann man es auch machen…
Dicke Verbotsschilder überall!  Einen solchen Aufsteller findet man im Zimmer. Darauf steht u. a., dass
Einen solchen Aufsteller findet man im Zimmer. Darauf steht u. a., dass
- Wer raucht 75 $ „Reinigungsgebühren“ bezahlen muss.
- Wer seinen Hund mit aufs Zimmer nimmt, 50 $ „Reinigungsgebühren“ bezahlen muss.
- Wer seinen Schlüssel verliert, 10 $ zahlt.
Hier wird der Gast richtig „erzogen“ und wehe, er spurt nicht, dann wird´s richtig teuer!
 und überall sind große Hinweise auf „Rauchverbot“ angebracht!
und überall sind große Hinweise auf „Rauchverbot“ angebracht! 
Hier im „Buffalo Run Inn“ in Marblemount geht man sogar noch weiter. Das Inn ist etwa 100 m vom Restaurant entfernt auf der anderen Straßenseite. Man muss auch im Restaurant einchecken, d. h. im Inn ist niemand.
Doch es gibt auch Dinge, die ich für sehr gelungen halte. Diese Dusche ist auch für Behinderte geeignet, obgleich sie auf den ersten Blick gar nicht so aussieht. 
Die Sitzbank ist übrigens auch hochzuklappen.
 Auch der Türstopper war sehr dezent oben an der Tür angebracht. Sehr gut!
Auch der Türstopper war sehr dezent oben an der Tür angebracht. Sehr gut!
Wie es immer so ist, wenn niemand im Hotel ist, vergisst man etwas, so auch hier: Nachdem ich glaubte, alles gecheckt zu haben, ließ ich den Schüssel im Zimmer – wie vorgeschrieben – und verließ das Inn. Als ich am Auto war, fiel mich jedoch ein, dass ich einige Säfte, den Rest Butter und etwas Käse im Kühlschrank deponiert hatte und da hatte ich – leider – nicht mehr nachgesehen. Doch ohne Schlüssel ins Hotel? No Chance! Na gut, Vergesslichkeit muss halt bestraft werden. Das Zimmermädchen wir sich – hoffentlich – freuen. Es sei ihr gegönnt.
Doch jetzt zu den schönen Dingen des Tages. Es war mal wieder so ein Tag, an dem ich – ich weiß nicht wie oft – „Gott ist das schön!“ ausgerufen habe. Da dieses Reisetagebuch jedoch kein Tonfilm oder eine Radiosendung ist, sollen jetzt in erster Linie Bilder sprechen, vielleicht mit dem einen oder anderen Kommentar.
Als ich morgens aus dem Fenster sah, sah es noch ziemlich grau aus. Doch als ich dann losfuhr, lösten sich die letzten Wolkenschwaden auf.
Erst im Tal … 
 …und später wurde es auch in höheren Lagen schöner.
…und später wurde es auch in höheren Lagen schöner.
 Gewaltige Schluchten begegneten mir im Diabolo Gebiet,
Gewaltige Schluchten begegneten mir im Diabolo Gebiet,
 in dem der Skagit River zum Diabolo Lake aufgestaut wird.
in dem der Skagit River zum Diabolo Lake aufgestaut wird. 
 Das Original…
Das Original…  …und die Erläuterung dazu. Hier wird – wie überall – das ganze System erläutert. Wirklich vorbildlich! Wie toll die Erläuterungen manchmal sind, zeigt dieser Vergleich. Einfach sehr gut! Da kapiert man etwas schneller, wie die Erdgeschichte funktioniert hat, denn wer glaubt schon, dass diese über 2.000 m hohen Gebirge einmal Meere waren!?
…und die Erläuterung dazu. Hier wird – wie überall – das ganze System erläutert. Wirklich vorbildlich! Wie toll die Erläuterungen manchmal sind, zeigt dieser Vergleich. Einfach sehr gut! Da kapiert man etwas schneller, wie die Erdgeschichte funktioniert hat, denn wer glaubt schon, dass diese über 2.000 m hohen Gebirge einmal Meere waren!?
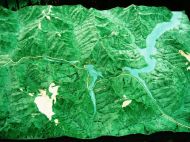
 Und auch künstliche Seen – sprich Stauseen – haben eine seltene Schönheit.
Und auch künstliche Seen – sprich Stauseen – haben eine seltene Schönheit.
 Und immer wieder Hinweise darauf, wie diese Region durch Gletscher und Vulkane entstanden ist. Ich kann das hier nicht genau wiedergeben, denn mir sind auch die englischen Begriffe nicht alle geläufig und da würde ich höchsten Fehler machen. Es soll ja auch keine geologische Studienfahrt sein, sondern einfach nur eine Beschreibung dessen, was die Natur so mit der Erde gemacht hat und wie schön sie es gemacht hat! Wer mehr wissen will, kann sich selbst bilden und Bücher nachlesen oder ins Internet gehen. Daher bewundern Sie einfach nur die schöne Landschaft. Vielleicht können Sie nachvollziehen, dass ich sehr oft „Mein Gott ist das schön!“ gejubelt habe.
Und immer wieder Hinweise darauf, wie diese Region durch Gletscher und Vulkane entstanden ist. Ich kann das hier nicht genau wiedergeben, denn mir sind auch die englischen Begriffe nicht alle geläufig und da würde ich höchsten Fehler machen. Es soll ja auch keine geologische Studienfahrt sein, sondern einfach nur eine Beschreibung dessen, was die Natur so mit der Erde gemacht hat und wie schön sie es gemacht hat! Wer mehr wissen will, kann sich selbst bilden und Bücher nachlesen oder ins Internet gehen. Daher bewundern Sie einfach nur die schöne Landschaft. Vielleicht können Sie nachvollziehen, dass ich sehr oft „Mein Gott ist das schön!“ gejubelt habe.




 Hinter jeder Kurve ein neuer Berg. Wer ist schöner und größer von diesen Bergen, die alle über 8 – 9.000 Fuß hoch sind, also alle 2.500 bis über 3.000 Meter hoch? Und auf dem 1.480 m hohen „Rainy Pass“ gab es nur harmlose Cirrus-Wolken, keinen Regen!
Hinter jeder Kurve ein neuer Berg. Wer ist schöner und größer von diesen Bergen, die alle über 8 – 9.000 Fuß hoch sind, also alle 2.500 bis über 3.000 Meter hoch? Und auf dem 1.480 m hohen „Rainy Pass“ gab es nur harmlose Cirrus-Wolken, keinen Regen!
Doch auf dem 5.477 Fuß = ca. 1.670 m hohen Washington Pass hat es mich dann doch von den Socken gehauen, wie man etwas burschikos sagen würde:
Gewaltiger Ausblick vom Washington Pass gen Süden.Traumhaft schöne Landschaft, durch gute Straßen mit wenigen Serpentinen sehr gut zu erreichen.
Steile Abhänge  und tiefe Täler
und tiefe Täler 
Wenn man diese Ausblicke genießt, denkt man unwillkürlich an die Alpen, um zu vergleichen. Von der landschaftlichen Schönheit kommen die Alpen sicherlich mit, doch mit einem – sehr großen – Unterschied: Keine Städte, keine Dörfer, keine Menschen und nur sehr wenige Autos! Das macht diese Berge so faszinierend und das ist es auch, was ich an den „Rockies“ – egal ob in den USA oder in Kanada – so liebe: Hier ist die Natur noch das alles beherrschende Element und der Mensch nur eine Winzigkeit.
Doch was diese Winzigkeit leisten kann, sieht man hier:  „May I take a picture” habe ich diese Lady gefragt und die Antwort sehen Sie.
„May I take a picture” habe ich diese Lady gefragt und die Antwort sehen Sie.
Ich war mehr als überrascht und erstaunt, wenn nicht gar ehrfürchtig, wie viele Radfahrer – und nicht wenige Frauen – sich durch die Rockies oder auch durch die bergischen Küstenstraßen per Rad bewegten. Und wie man sieht: Nicht „exhausted“, wie ich es sicherlich wäre, obgleich ich gerne Rad fahre, nur nicht so extrem. Man muss es ja nicht gleich übertreiben. Doch nicht nur diese nette Lady nahm die Strapazen auf sich – lächelnd und völlig locker. Kompliment!
Der große Berg muss grad mal ein bisschen  Wasser lassen.
Wasser lassen.

 Doch wenn man so viel Großes gesehen hat, sollte man – zumindest tut ich das – sich auch mal unten im Tal wieder den kleinen Naturschönheiten widmen.
Doch wenn man so viel Großes gesehen hat, sollte man – zumindest tut ich das – sich auch mal unten im Tal wieder den kleinen Naturschönheiten widmen.
Nach diesen gewaltigen Bergen ist man wieder zurück im menschlichen Leben, in Winthrop. Ein kleiner Ort am Rande der Cascades und der Okanogan Region – sollen wir sagen in der Halbwüste?







 Winthrope, ein Ort wie im Film! Und das ist so gewollt, wie ich von einem Ladenbesitzer gesagt bekommen habe, als ich ihn fragte: „Is that the policy of the village?“ „Yes, it is!“ Phantastisch!
Winthrope, ein Ort wie im Film! Und das ist so gewollt, wie ich von einem Ladenbesitzer gesagt bekommen habe, als ich ihn fragte: „Is that the policy of the village?“ „Yes, it is!“ Phantastisch!
Ein Laden ist verrückter als der andere und wenn Sie sich die vielen „cracy ideas“ anschauen, werden Sie mir sicherlich recht geben:
 Wer wirft da nicht eine Münze rein? Oder möchten Sie ein schlechtes Karma? Ich nicht! Also habe ich Münzen reingeworfen.
Wer wirft da nicht eine Münze rein? Oder möchten Sie ein schlechtes Karma? Ich nicht! Also habe ich Münzen reingeworfen.

 Haben Sie schon mal auf solchen Hockern gesessen? Herrlich verrückt, oder?! Ein Mädchen am Nebentisch wollte, dass sich ihr kleines Brüderchen zum Eis essen an den Tisch der Familie setzte, doch der wollte nicht, sondern setzte sich lieber auf den Sattel. Sollte die Familie zuhause auch so machen, dann würde er nicht anderswo sitzen wollen!
Haben Sie schon mal auf solchen Hockern gesessen? Herrlich verrückt, oder?! Ein Mädchen am Nebentisch wollte, dass sich ihr kleines Brüderchen zum Eis essen an den Tisch der Familie setzte, doch der wollte nicht, sondern setzte sich lieber auf den Sattel. Sollte die Familie zuhause auch so machen, dann würde er nicht anderswo sitzen wollen!
 Dieser Ort hat offenbar Erfolg mit seiner Marketing-Methode, denn die nächste Großstadt ist mindestens zwei Autostunden – wenn nicht mehr – entfernt. Ich bin einfach immer wieder begeistert, wenn es Menschen gibt, die es verstehen, aus einem alten Ort im Nirgendwo etwas zu machen, wo Andere glauben, die Leute wollen sowas nicht. Das ist Marketing in Höchstform!
Dieser Ort hat offenbar Erfolg mit seiner Marketing-Methode, denn die nächste Großstadt ist mindestens zwei Autostunden – wenn nicht mehr – entfernt. Ich bin einfach immer wieder begeistert, wenn es Menschen gibt, die es verstehen, aus einem alten Ort im Nirgendwo etwas zu machen, wo Andere glauben, die Leute wollen sowas nicht. Das ist Marketing in Höchstform!
Dabei denke ich immer wieder an den Ort San Louis Obispo – komplizierte Namen kann ich mir normalerweise nicht merken, doch diesen Namen werde ich wohl nie vergessen. Er liegt irgendwo zwischen Los Angeles und San Franzisco – in the middle of nowhere – und hat das wohl am besten ausgelastete Hotel der Welt: „The Madonna Inn!“. Ich war einmal mit einigen Romantik Hoteliers dort, um es zu besichtigen, doch Zimmer zu bekommen war aussichtslos. Es war auf Monate hinaus ausgebucht, vielfach von Honeymooners. Es ist so kitschig, wie man es sich kitschiger nicht vorstellen kann. Doch das war Absicht der Eigentümer Phyllis und Axel Madonna: Jedes Zimmer anders: das eine wie ein Eisberg, das andere in einer Höhle, das dritte im Urwald etc. Wir mussten leider in einem Motel übernachten und konnten dort am nächsten Morgen nur frühstücken und uns an der Herrentoilette mit Wasserfall (!) erfreuen. Auch das war bzw. ist Marketing in Höchstform!


 Die hohen Berge waren hinter Winthrope Vergangenheit und die weniger hohen breiteten sich aus. Auch die Temperatur änderte sich gewaltig und ich musste meine lange gegen eine kurze Hose austauschen, um nicht im eigenen Schweiß zu baden.
Die hohen Berge waren hinter Winthrope Vergangenheit und die weniger hohen breiteten sich aus. Auch die Temperatur änderte sich gewaltig und ich musste meine lange gegen eine kurze Hose austauschen, um nicht im eigenen Schweiß zu baden.
 Schon wieder eine „Stop and Slow“ Baustelle
Schon wieder eine „Stop and Slow“ Baustelle
 Der Okanogan-River sorgt dafür, dass diese Region berühmt ist für sein Obst.
Der Okanogan-River sorgt dafür, dass diese Region berühmt ist für sein Obst.
Man ist bzw. ich bin immer wieder überrascht, dass in einer nahezu baumlosen Gegend – das sieht man ja auf dem Bild – und bei 30 ° Celsius und nicht etwa Fahrenheit (das wäre ja: brrrr) so viel Obst wachsen kann. Doch das ist – so glaube ich – nur durch die Flüsse möglich: Wo Wasser ist, ist auch Leben!
Ein ganz anderer Fluss ist der Columbia River! Dagegen sind alle anderen Flüsse nur Peanuts. Sowohl von der Mächtigkeit als auch von der Geschichte her betrachtet.
 Das ist er, der Columbia River. Heute zum zweiten Mal, denn beim ersten Mal sah ich ihn auf dem Weg nach Norden bei Hood River.
Das ist er, der Columbia River. Heute zum zweiten Mal, denn beim ersten Mal sah ich ihn auf dem Weg nach Norden bei Hood River.
Mich wunderte nur, dass er hier gen Norden und nicht etwa nach Süden floss. Doch auf der Landkarte sah ich, dass er vom Grand Coulee Dam aus einen mächtigen Bogen erst nach Norden und dann nach Westen macht, bevor er dann in südliche Richtung fließt. Jetzt kam mir wieder das in den Sinn, über das ich eingangs geschrieben hatte, als ich mich mit der Vorbereitung auf diese Reise beschäftigt hatte: Lake Missoula.
Den Columbia River kann es – nach meiner unmaßgeblichen Meinung – vor der Eiszeit noch gar nicht gegeben haben, (Protest! Protest! Werden einige Wissenschaftler jetzt wohl schreien) doch will ich das im Augenblich wirklich wissen? Auf jeden Fall dürfte folgendes interessant sein: Der „Grand Coulee Dam“ nutzt einfach nur die natürlich Barriere aus, die hier vorhanden ist: ein Unterschied von über 700 Fuß zwischen dem heutigen Baker Lake und dem Staudamm. Eigentlich sind es zwei Staudämme, nämlich der kleine Damm, der den Baker Lake aufhält und der weitaus mächtigere Coulee Damm, der den „Reservoir“ Franklin Lake aufhält.
Doch – und da fängt meine Theorie an – staute sich genau an dieser Barriere der vorzeitliche Missoula Lake, der ja nur aus Eis bestand. Als es langsam wärmer wurde, begann natürlich auch das Eis zu schmelzen. Doch wie es bei Eis nun mal der Fall ist: es dauert seine Zeit bis es flüssig wird und ein paar Brocken bleiben immer übrig. Diese Eispfropfen verstopften den Abfluss des Schmelzwassers zum 700 Fuss höher gelegenen Ausgang nach Süden. Vielleicht war der Unterschied damals noch größer oder kleiner. Nun genau werden wir es wohl nie wissen, doch die Wissenschaftler sind sich da einig: Irgendwann brach der Eisdamm und das Schmelzwasser mit vielen Eisschollen und –bergen bahnte sich einen gewaltigen Weg nach Süden! So gewaltig, dass er nicht eine kleine „Gorge“ bildete, sondern eine gewaltige Schlucht von mehreren Kilometern Breite, die nicht V-förmig, sonder U-förmig war, so unbändig war die Kraft.
Diese breite Schlucht suchte ich, als ich südlich weiter fuhr, doch zunächst noch einige Impressionen vom Coulee Damm:



 Der „Grand Coulee Dam“, einer der größten Staudämme der Welt mit dem Franklin Lake.
Der „Grand Coulee Dam“, einer der größten Staudämme der Welt mit dem Franklin Lake.


Doch für mich war wirklich viel wichtiger, wie sah es südlich davon aus? Was hatten die Eis- und Wassermassen angerichtet, als sie den Durchbruch schafften? Ich machte viele Bilder doch dann hatte ich die richtige Stelle gefunden, die das – nach meiner Meinung – sehr deutlich macht:


 Hier war – offenbar – der Durchbruch des Lake Missoula! Das sind mindestens zwei wenn nicht mehr Kilometer Breite.
Hier war – offenbar – der Durchbruch des Lake Missoula! Das sind mindestens zwei wenn nicht mehr Kilometer Breite.
 Das ist der Steamboot Rock im
Das ist der Steamboot Rock im  Banks Lake als markantes Überbleibsel, und hier im „Bureau of Reclamation“ beschwere sich, wer wolle. Ich nicht! (Genau übersetzt ist es das „Büro für Landgewinnung“)
Banks Lake als markantes Überbleibsel, und hier im „Bureau of Reclamation“ beschwere sich, wer wolle. Ich nicht! (Genau übersetzt ist es das „Büro für Landgewinnung“)
 Das muss das ausgewaschene Bett sein, über das die Wassermassen gen Süden schossen.
Das muss das ausgewaschene Bett sein, über das die Wassermassen gen Süden schossen.
Noch imposanter wird es, wenn man weiter südlich fährt und die „Dry Falls“ bei Coulee City besichtigt:
 Wasserfälle ohne Wasserfall? Gibt’s das überhaupt? Ja, hier! Die Dry Falls. 120 m Fallhöhe und ca. 5 km breit! Größer als die Niagara-Fälle mit Wasser!
Wasserfälle ohne Wasserfall? Gibt’s das überhaupt? Ja, hier! Die Dry Falls. 120 m Fallhöhe und ca. 5 km breit! Größer als die Niagara-Fälle mit Wasser!
Über diese Kante ist der Missoula Lake – und nicht nur hier – gen Süden geschossen und hat alles mitgerissen, was es nur gab. Alles an Schlamm, Geröll, Erde und was es sonst noch gab, würde mitgerissen und landete zum Teil im Pazifik, doch zum Teil auch im Williamette-Tal, das dadurch seine heutige Fruchtbarkeit bekommen hat. Ist das nicht eine faszinierende Geschichte?
Hier die Erläuterungen zu dieser Naturkatastrophe und das Bild, das ich schon zu Beginn meines Berichtes gezeigt habe.
Und durch diese Schlucht haben sich die Wasser- und Eismassen weiter nach Süden gewälzt.

 Danach wird das Tal breiter und friedlicher und führt in den „Soap Lake“, der schon bei den Indianern ein heilsamer See war.
Danach wird das Tal breiter und friedlicher und führt in den „Soap Lake“, der schon bei den Indianern ein heilsamer See war.
 Seine Mineralien sind so gesund, dass sie jährlich hier herkamen und badeten, sich mit dem schwarzen Schlamm beschmierten, um gesund zu werden oder zu bleiben.
Seine Mineralien sind so gesund, dass sie jährlich hier herkamen und badeten, sich mit dem schwarzen Schlamm beschmierten, um gesund zu werden oder zu bleiben.  Auf einer Info-Tafel erfuhr ich, dass es nur zwei Orte auf der Welt gibt, die diesen Schlamm vorweisen können: der Soap Lake und: Baden-Baden!
Auf einer Info-Tafel erfuhr ich, dass es nur zwei Orte auf der Welt gibt, die diesen Schlamm vorweisen können: der Soap Lake und: Baden-Baden!
Wie das aussieht, wenn sich „Weiße“ so einschmieren, sieht man hier:  Schwarze Weiße!
Schwarze Weiße!
Doch selbst die Vögel machten sich die Besonderheiten des Sees nutzbar:  Möwen stampften mit den Füßen im Schlamm (sieht man vielleicht in der Bildmitte), um Fressbares aufzuwirbeln.
Möwen stampften mit den Füßen im Schlamm (sieht man vielleicht in der Bildmitte), um Fressbares aufzuwirbeln.
 Mein günstiges „Master“-Motel in Soap Lake
Mein günstiges „Master“-Motel in Soap Lake  Es ist fast Vollmond!
Es ist fast Vollmond!
Es gäbe noch viele Kleinigkeiten, über die es zu berichten lohnt, doch jetzt ist es bereits ¼ nach 12 – d. h. nach Mitternacht – und es wird Zeit für mich ins Bett zu gehen. (Mein Gott, sonst arbeite ich doch auch nicht so lange…)
Donnerstag, den 3. September 2009
Als ich das erste Mal aufwachte, war es erst halb sieben. Da wollte ich noch nicht aufstehen und so drehte ich mich noch einmal um. Als ich dann wieder wach wurde, hörte ich ein komisches Rauschen: Es regnete!
 Doch der Regen war nur eine kleine Episode, denn die Sonne kam schon wieder durch.
Doch der Regen war nur eine kleine Episode, denn die Sonne kam schon wieder durch.
Eigentlich hatte ich keinen direkten Plan, denn gen Westen zu fahren, um die Berge zu sehen, die ich eigentlich auf der Hinreise besuchen wollte, machte wenig Sinn. Bei dem heutigen Wetter, bei dem Regen im Westen angekündigt worden war, war zu erwarten, dass die Berge sowieso in den Wolken verschwinden würden. Also fuhr ich zunächst gen Süden, um zum Moses Lake zu kommen.
 Selten: Pfützen auf der Straße in der Halb-Wüste!
Selten: Pfützen auf der Straße in der Halb-Wüste!  Kein Baum und Strauch soweit das Auge reicht.
Kein Baum und Strauch soweit das Auge reicht.
Da ich Moses Lake nicht so besonders reizvoll fand, habe ich einen Entschluss gefasst und bin doch nach Westen abgebogen, zumal die Wolken im Süden schon komisch schleierhaft aussahen, so dass sich hier vielleicht etwas zusammenbraut, während es im Westen schon wieder schön zu werden schien.  Und so kam es denn auch: Sonnenschein auf der Weiterfahrt.
Und so kam es denn auch: Sonnenschein auf der Weiterfahrt.
 Da hinten, wo der Einschnitt zu erkennen ist, fließt der Columbia River
Da hinten, wo der Einschnitt zu erkennen ist, fließt der Columbia River  und hier ist er zu sehen.
und hier ist er zu sehen.
Da ist er wieder: Der Columbia River! Leicht gestaut, wie es ihm auf seiner langen Reise sehr oft passiert, um seine Kraft zu Strom und sein Wasser zu Obst werden zu lassen. Das Columbia-Becken ist eines der größten Obstanbaugebiete der USA und die Stadt Wenatchee nennt sich „The Apple Capital of the World“, was denn sonst!? Ob die Einwohner schon mal was von Jork im „Alten Land“ bei Hamburg oder von Südtirol gehört haben? Ich glaube nicht. Doch das ist Amerika. Wenn hier was besonders groß ist, dann ist es das Größte auf der Welt (hatten wir ja schon erwähnt!). Andere Länder existieren oder interessieren ganz einfach nicht.
 Nördlich von Wenatchee biegt der Highway 2 nach Westen ab und die Landschaft ändert sich erneut von wenig bewachsenen Hügeln zu Tannenwäldern.
Nördlich von Wenatchee biegt der Highway 2 nach Westen ab und die Landschaft ändert sich erneut von wenig bewachsenen Hügeln zu Tannenwäldern.
 Man kommt zunächst nach Cashmere ( da kommen aber nicht die Cashmere-Pullover her!). Meine geplante Route sollte weiter über die 97 nach Süden gehen, doch einen kurzen Abstecher nach Leavenworth musste einfach sein: Bayern in den USA in Hochformat! Leider zog sich der Himmel wieder zu und es fing an zu regnen, so dass man nicht so tolle Fotos machen konnte.
Man kommt zunächst nach Cashmere ( da kommen aber nicht die Cashmere-Pullover her!). Meine geplante Route sollte weiter über die 97 nach Süden gehen, doch einen kurzen Abstecher nach Leavenworth musste einfach sein: Bayern in den USA in Hochformat! Leider zog sich der Himmel wieder zu und es fing an zu regnen, so dass man nicht so tolle Fotos machen konnte.
 Es gibt natürlich einen Maibaum in Leavenworth…
Es gibt natürlich einen Maibaum in Leavenworth… …und der Innkeeper trägt Lederhosen!
…und der Innkeeper trägt Lederhosen!

 Sieht aus wie in Oberammergau
Sieht aus wie in Oberammergau  (Hoffentlich fühlt sich jetzt kein Oberammergauer beleidigt…)
(Hoffentlich fühlt sich jetzt kein Oberammergauer beleidigt…)
 Das Rivers Inn mit abgewandelten Bayern-Wappen
Das Rivers Inn mit abgewandelten Bayern-Wappen  Und selbst McDonald hat sein Erscheinungsbild an der „Alpensee Strasse“ angepasst. Das nenne ich Marketing!
Und selbst McDonald hat sein Erscheinungsbild an der „Alpensee Strasse“ angepasst. Das nenne ich Marketing!
Von dieser Kopie eines bayerischen Dorfes – ob der Seehofer bei seinem nächsten USA-Besuch mal vorbeischaut? Das wär a Gaudi! Alle hier würden sicherlich „Halleluja!“ rufen – fuhr ich das kurze Stück zurück, um auf der 97 gen Süden zu fahren.

 Immer wieder unterschiedliche Landschaften machen das Reisen besonders angenehm und abwechslungsreich.
Immer wieder unterschiedliche Landschaften machen das Reisen besonders angenehm und abwechslungsreich.
Besonders schön finde ich die Strecke zwischen Ellensburg und Yakima, aber nicht über die 97 bzw. 82, sondern über die 821 durch den Yakima Canyon.  „Yakima“ soll auf indianisch heißen: „Der Fluss, der aus dem Canyon kommt“ und das passt genau.
„Yakima“ soll auf indianisch heißen: „Der Fluss, der aus dem Canyon kommt“ und das passt genau.

 Er schlängelt sich durch das Hügelland und soll – lt. dieser Tafel – älter sein, als die Berge selbst, die erst durch die Erdverwerfungen entstanden sind, durch die sich dann der Yakima wieder seinen Weg gegraben hat.
Er schlängelt sich durch das Hügelland und soll – lt. dieser Tafel – älter sein, als die Berge selbst, die erst durch die Erdverwerfungen entstanden sind, durch die sich dann der Yakima wieder seinen Weg gegraben hat.

 Er ist beliebt bei Freizeit-Kapitänen, die auch immer einige Dosen Bier dabei haben…
Er ist beliebt bei Freizeit-Kapitänen, die auch immer einige Dosen Bier dabei haben…
 Über den Fluss da führt ein Steg… – in Form einer Hängebrücke –
Über den Fluss da führt ein Steg… – in Form einer Hängebrücke –  und eine Eisenbahn fährt auch noch durchs Tal.
und eine Eisenbahn fährt auch noch durchs Tal.
In Yakima bin ich dann über den Highway 12 hoch in die Berge bis zum Chinook Pass auf 5.430 Fuß hochgefahren. Die Strecke selbst führt nur durch Tannenwälder, so dass man keine Berge, sondern links und rechts nur Tannen sieht. Erst oben auf dem Pass hat man eine herrliche Sicht auf die Berge.
Da es schon fünf Uhr nachmittags war, lohnte es nicht mehr, in den  Mt. Rainier Nationalpark zu fahren, wobei die Kasse um diese Zeit allerdings auch schon geschlossen war. Auch war ich reichlich müde und wollte zusehen, eine Unterkunft zu finden, was bei den Nationalparks ja schon mal Schwierigkeiten gemacht hat (siehe meine Versuche beim Lassen-Park vor einigen Tagen…)
Mt. Rainier Nationalpark zu fahren, wobei die Kasse um diese Zeit allerdings auch schon geschlossen war. Auch war ich reichlich müde und wollte zusehen, eine Unterkunft zu finden, was bei den Nationalparks ja schon mal Schwierigkeiten gemacht hat (siehe meine Versuche beim Lassen-Park vor einigen Tagen…)
 Herrliche Stauden am Wegesrand.
Herrliche Stauden am Wegesrand.
So bin ich denn bis Packwood gefahren, wo ich jetzt im Packwood Inn sitze und diesen Tagesbericht schreibe.
 Mein Motel, das „Packwood Inn“
Mein Motel, das „Packwood Inn“  Man sieht vom Ort – der sich „The Gateway to Mt. Rainier and Mt. St. Helens“ nennt –
Man sieht vom Ort – der sich „The Gateway to Mt. Rainier and Mt. St. Helens“ nennt –  noch die Spitze des Mt. Rainier und der St. Helens ist nicht weit. Diese Aussage stimmt somit auf jeden Fall.
noch die Spitze des Mt. Rainier und der St. Helens ist nicht weit. Diese Aussage stimmt somit auf jeden Fall.
So, und jetzt habe ich Hunger und gehe nach nebenan Pizza essen! Nun, es gibt so´ne und so´ne Pizzerien. Diese war nun schon die zweite, die mich negativ überrascht hat: Kein netter Italiener, wie man das bei uns so kennt und liebt, sondern eine mehr oder wenige kalt eingerichtete Wartehalle mit Stühlen und Tischen, eine große Theke, an der man seine Pizza bestellen und die Zutaten selbst aussuchen muss (kann, wenn man´s positiv ausdrücken will), dahinter eine „Pizza-Fabrik“, wie sie hässlicher nicht sein kann, und dann zahlt und wartet man, bis die Pizza fertig ist.
Da kommt kein Gefühl auf, die Pizza hier zu verzehren, sondern nimmt sie lieber mit aufs Zimmer. Für eine Small Pizza mit Champignons immerhin 12 $ plus Tax auch nicht gerade preiswert. Die war dann allerdings so dick und mit viel Käse, dass ich nur die Hälfte verzehren konnte.
Freitag, der 4. September 2009
Nun, das Wetter sieht einigermaßen gut aus, obgleich eine neue Regenfront für Washington angekündigt worden ist. Mal sehen, wie das Wetter sich so entwickelt. Und manchmal hat man ja wirklich Glück, so wie ich es heute haben sollte…

 Als ich um 9.00 Uhr losfuhr, sah der Fleemarket noch ganz verschlafen aus und auch Mt. Rainier hatte noch seine Schlafmütze auf.
Als ich um 9.00 Uhr losfuhr, sah der Fleemarket noch ganz verschlafen aus und auch Mt. Rainier hatte noch seine Schlafmütze auf.
Doch als ich ihm langsam näher kam, hat er sich von seiner schönsten Seite gezeigt:
 Postkartenfoto, nicht wahr? Mount Rainier – 14.411 Fuß hoch = 4.392 Meter, der höchste Berg der Cascade Mountains.
Postkartenfoto, nicht wahr? Mount Rainier – 14.411 Fuß hoch = 4.392 Meter, der höchste Berg der Cascade Mountains.

 Diese 50 m tiefe Schlucht galt es noch zu überwinden. (Zum Glück gab es eine Brücke)
Diese 50 m tiefe Schlucht galt es noch zu überwinden. (Zum Glück gab es eine Brücke)
Es hat sich also gelohnt, die 7 Meilen von Packwood zurück zu fahren und dann hinauf auf den Berg bis zum „Paradies“, wie es hier oben genannt wird. Daher lassen wir das Paradies für sich selbst sprechen und genießen es (fast) schweigend.
 Herrlicher Berg mit mächtigen Gletschern
Herrlicher Berg mit mächtigen Gletschern 

 und tolle Beeren und Blumen
und tolle Beeren und Blumen 






 Vielfältige Pflanzen und
Vielfältige Pflanzen und
 tolle Ausblicke auf den Mt. Rainier
tolle Ausblicke auf den Mt. Rainier 


 Murmeltiere und Rehe gab es auch.
Murmeltiere und Rehe gab es auch.

 Weiter sollte man sich als Tourist besser nicht vor wagen.
Weiter sollte man sich als Tourist besser nicht vor wagen.


 Doch auch die umliegenden Berge im Süden sind faszinierend, auch wenn dicke Wolken aufkommen.
Doch auch die umliegenden Berge im Süden sind faszinierend, auch wenn dicke Wolken aufkommen.


 Kleine Murmeltier Casting-show? Natürlich gerne!
Kleine Murmeltier Casting-show? Natürlich gerne!

 Irgendwann muss man sich von diesen Naturschönheiten, um nicht -wundern zu sagen trennen und den Rückweg antreten.
Irgendwann muss man sich von diesen Naturschönheiten, um nicht -wundern zu sagen trennen und den Rückweg antreten.
 Interessant auch die Infos, die man beim Hotel bekommt. Das Hotel heute (Anfang September 2009)
Interessant auch die Infos, die man beim Hotel bekommt. Das Hotel heute (Anfang September 2009)
 und hier auf einer Info-Tafel im Winter: Schnee bis zu die Fenstern! Der Durchschnitt liegt bei 640 Inches = ca. 1,60 m, und manchmal bis zu 1.122 Inches, = ca. 2,90 m.
und hier auf einer Info-Tafel im Winter: Schnee bis zu die Fenstern! Der Durchschnitt liegt bei 640 Inches = ca. 1,60 m, und manchmal bis zu 1.122 Inches, = ca. 2,90 m.
 Das schlechte Wetter kommt schnell näher.
Das schlechte Wetter kommt schnell näher.
 Die Spuren früherer Gletscher.
Die Spuren früherer Gletscher.
Die Geschichte des Nationalparks ist für mich erstaunlich. Bereits 1899, also noch nicht einmal 100 Jahre nachdem Lewis und Clark 1806 den Weg nach Westen erkundet haben, wurde die Region um den Mt. Rainier zum Nationalpark erklärt. Das muss man sich mal vorstellen: In einem Gebiet, dass bis dahin fast ausschließlich von der Nutzung der Wälder durch den Pelztierhandel und die Holzindustrie gelebt hat, wurde von Wissenschaftlern, Persönlichkeiten und auch Kaufleuten die Idee des Naturschutzes durchgesetzt. Und das in einem Land, das heute noch immer nicht in der Lage ist, das Kyoto II-Protokoll zu ratifizieren, weil die mächtigen Industrien es blockieren! Das ist schon bedeutend!
Wenn man es mit Deutschland vergleicht, wie lange es bei uns gedauert hat, die ersten Nationalparks zu gründen. Um sich das mal gedanklich vorzustellen, würde es praktisch bedeuten, die Region um die Zugspitze wäre bereits im Mittelalter oder gar noch früher zum Nationalpark erklärt worden. Unvorstellbar!
Bei allen kritischen Dingen, die ich hin und wieder auch hier angemerkt habe, finde ich die Nationalparks als hervorragende Umweltschutzbeispiele für die ganze Welt. Das trifft natürlich auch und ganz besonders für den Yosemite-Nationalpark zu, dem ersten Nationalpark der USA, der bereits am 1. Oktober 1890 ins Leben gerufen worden ist!
 Doch der Mt. Rainier war nicht das einzige Highlight des Tages und jetzt kommt das Glück hinzu. Der Himmel zog sich zwar langsam zu. Im Süden wurden die Wolken immer dichter und verdeckten die Sonne. Manche sahen so aus, als ob sie schon Regen abgaben. Doch sie verzogen sich auch wieder und so hatte ich gute Chancen, auch die anderen Berge an diesem Tage ohne Wolken zu erleben.
Doch der Mt. Rainier war nicht das einzige Highlight des Tages und jetzt kommt das Glück hinzu. Der Himmel zog sich zwar langsam zu. Im Süden wurden die Wolken immer dichter und verdeckten die Sonne. Manche sahen so aus, als ob sie schon Regen abgaben. Doch sie verzogen sich auch wieder und so hatte ich gute Chancen, auch die anderen Berge an diesem Tage ohne Wolken zu erleben.
Auf der Weiterfahrt sah ich dieses Schild:  Vulkan Fluchtweg!
Vulkan Fluchtweg!
Das kann ja nur bedeuten, dass der Mt. St. Helens nicht mehr weit sein kann.
 Das ist er noch nicht, sondern der Mt. Adams…
Das ist er noch nicht, sondern der Mt. Adams…  …aber das ist Mt. St. Helens. Wieder ganz friedlich.
…aber das ist Mt. St. Helens. Wieder ganz friedlich.  Jetzt schon etwas näher.
Jetzt schon etwas näher.
Vor nahezu 30 Jahren ist im praktisch der Kopf weggeflogen! Eine riesige Explosion hat ihn 400 Meter seiner Höhe gekostet, als er im Frühjahr 1980 ausbrach und er von 2.950 m auf 2.549 m Höhe schrumpfte. Riesige Aschemengen sind bis zu 18 km in die Luft geflogen und haben im nahen Portland den Tag zur Nacht werden lassen und viel, viel zum Putzen hinterlassen…
Insgesamt sind 62 Menschen dabei ums Leben gekommen, von den Tieren ganz zu schweigen.


 Der Silver-Lake am Fuße des St. Helens ist durch den Vulkanausbruch nur mal eben so um eine halbe Meile nach Norden verschoben worden und die toten Bäume schwimmen immer noch auf ihm herum, weil sie nicht verfaulen.
Der Silver-Lake am Fuße des St. Helens ist durch den Vulkanausbruch nur mal eben so um eine halbe Meile nach Norden verschoben worden und die toten Bäume schwimmen immer noch auf ihm herum, weil sie nicht verfaulen.
Und wie mir ein Officer sagte – oder wie sein Titel auch immer lautete, denn er war mit einem Wagen unterwegs, auf dem stand „Law-Enforcement“ – dass immer noch bis zu einem Meter große Fische in dem See leben, obgleich der See beim Ausbruch nur so gebrodelt und gekocht hat, dass eigentlich alles Lebenden darin gegart worden sein müsste. Es herrschten nach dem Ausbruch immerhin über 600 ° Grad Hitze (nicht Fahrenheit sondern Celsius)! Die Natur ist schon sonderbar! Wie können Fische in kochendem Wasser überleben? (Inzwischen konnte ich – natürlich im Internet – herausfinden, dass „Law Enforcement“ eine Ausbildungseinrichtung der Polizei ist und dem Heimatschutzministerium untersteht.)



 Einige Bäume verbrannten zwar, doch sie blieben aufrecht stehen. Inzwischen wachsen neue Bäume heran, während diese immer noch daliegen wie nach dem Ausbruch, doch neues Leben wächst auch hier nach. Das ist die Natur!
Einige Bäume verbrannten zwar, doch sie blieben aufrecht stehen. Inzwischen wachsen neue Bäume heran, während diese immer noch daliegen wie nach dem Ausbruch, doch neues Leben wächst auch hier nach. Das ist die Natur!
Wenig Glück hatte ich abends mit dem Hotel St. Martin in Carson und auch mit dem Restaurant im gleichen Ort, doch wen interessiert das an einem solchen Tag schon?
Und morgen geht´s zurück nach Oregon. Man könnte jetzt auch sagen: Südwärts nach Oregon. Und da werde ich mir noch etwas mehr vom Columbia River ansehen, wenn das Wetter mitspielen sollte, denn es ist Regen angesagt. Doch warten wir´s mal ab.
Samstag, der 5. September 2009
Und es war Regen. Dauerregen! Als ich um 7:00 Uhr (!) vom Hotel losfuhr, fing es leicht an zu nieseln. Doch als ich nach wenigen Minuten dem Columbia River „Guten Morgen“ sagen wollte, zog er seine dicke Decke noch tiefer ins Gesicht.
 Der Columbia-River – nicht von seiner schönsten Seite. Er war wohl etwas beleidigt, dass ich ihn bisher auf meiner Reise zwar dreimal besucht, doch eigentlich nie so richtig gewürdigt habe. Das braucht so ein großer Fluss, da bin ich mir ganz sicher!!!
Der Columbia-River – nicht von seiner schönsten Seite. Er war wohl etwas beleidigt, dass ich ihn bisher auf meiner Reise zwar dreimal besucht, doch eigentlich nie so richtig gewürdigt habe. Das braucht so ein großer Fluss, da bin ich mir ganz sicher!!!
 Auf „Der Brücke der Götter“ habe ich ihn – den Columbia River – für nur 1 $ überquert.
Auf „Der Brücke der Götter“ habe ich ihn – den Columbia River – für nur 1 $ überquert.
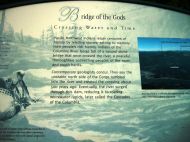 Wie auf der Info-Tafel zu lesen ist, muss das hohe Nordufer der Columbia Gorge – d. h. der Schlucht – wohl irgendwann mal abgerutscht sein und hat den Fluss versperrt. Dadurch wurde ein natürlicher Übergang geschaffen: „Gottes Brücke“ nach indianischer Auffassung. Später hat er sich dann wieder einen Weg gebahnt. Doch ist der Durchfluss an dieser Stelle sehr eng, sodass man dann später hier einen Staudamm und diese Brücke errichtet hat.
Wie auf der Info-Tafel zu lesen ist, muss das hohe Nordufer der Columbia Gorge – d. h. der Schlucht – wohl irgendwann mal abgerutscht sein und hat den Fluss versperrt. Dadurch wurde ein natürlicher Übergang geschaffen: „Gottes Brücke“ nach indianischer Auffassung. Später hat er sich dann wieder einen Weg gebahnt. Doch ist der Durchfluss an dieser Stelle sehr eng, sodass man dann später hier einen Staudamm und diese Brücke errichtet hat.
Auf der Südseite bin ich dann über die historische Straße und nicht auf der Autobahn weiter gefahren, doch man sah nicht viel, außer Wolken, Regen und tropfende Bäume. Selbst an einem Ausgucksplatz war nicht viel zu sehen, obgleich die Landschaft schon gewaltig aussehen muss:
 Sehen Sie was? Die Columbia Schlucht im Regen…
Sehen Sie was? Die Columbia Schlucht im Regen… …und die hohen Ufer in den Wolken.
…und die hohen Ufer in den Wolken.
Nun, was will ich denn? Die ganze Zeit hatte ich sehr viel Glück mit dem Wetter. Man stelle sich nur einmal vor, der gestrige „Gipfel-Tag“ wäre so regnerisch gewesen wie heute! Doch bei diesem Wetter macht es keinen Sinn, auf Landstraßen weiterzufahren und doch nichts zu sehen.
Also überlegte ich, dass die einzige Chance, noch gutes Wetter zu erwischen, an der Küste liegen könnte, da der Tiefausläufer von Südwesten gekommen war und laut Wetterbericht nach Nordosten zog. So nahm ich die Interstate 84 bis kurz vor Portland und bog dann auf die 205 gen Süden ab, um irgendwann auf dem Highway 213 der schrecklichen Autobahn zu entkommen, denn der Motorway war sehr voll und es regnete weiter ununterbrochen.
Viele Fans der „Oregon Beavers“ (Football), zu erkennen an den Fahnen, Schals und was sonst noch, waren auf dem Weg nach Corvallis, also genau die Strecke, die ich auch gewählt hatte. Es kam durch einen kleinen Unfall sogar noch zu einem Stau, der allerdings nicht lange dauerte. Doch irgendwann hatte ich das Ziel der Beavers, das „Colosseum“ in Corvallis, hinter mir und dann ging es ganz vernünftig auf der 20 weiter gen Westen.
Vorher – auf der 213 – habe ich noch ein Foto gemacht, dass es mir trotz des Regens wert war auszusteigen und ein Foto im Regen machen: Tannenbäume!  Die Tannenbäume sind hier alle sehr stark getrimmt. Das war mir schon letzte Woche aufgefallen, als ich schon einmal durchs Williamette Tal gefahren bin. Entweder ist das eine spezielle Zucht oder sie werden ständig getrimmt. Das habe ich nicht herausbekommen.
Die Tannenbäume sind hier alle sehr stark getrimmt. Das war mir schon letzte Woche aufgefallen, als ich schon einmal durchs Williamette Tal gefahren bin. Entweder ist das eine spezielle Zucht oder sie werden ständig getrimmt. Das habe ich nicht herausbekommen.
Und was soll ich Ihnen sagen – Sie werden es nicht glauben – gegen Mittag kamen die ersten Sonnenstrahlen durch, und als ich um halb eins in Newport ankam, strahlte die Sonne über beide Ohren! Meine guten Verbindungen zu Petrus sind dank Hermes, dem Götterboten, offenbar auch hier in Amerika noch sehr gut!
 Newport im Sonnenschein, doch über dem Land liegen die Wolken immer noch – das blieb den ganzen Tag über so – dicke Wolken. Nur nicht, wo ich war. Danke, Petrus!
Newport im Sonnenschein, doch über dem Land liegen die Wolken immer noch – das blieb den ganzen Tag über so – dicke Wolken. Nur nicht, wo ich war. Danke, Petrus!
Die Hafenstraße in Newport ist eine interessante Mischung aus traditionellem Fischfang mit seinen zum Teil stinkenden Fischfabriken und einer Touristenattraktion ersten Ranges. Hier lebte nicht nur „Keiko“ der Orka-Wal aus dem Film „Free Willy“, der wohl berühmteste Orka, der dann vor einigen Jahren per Flugzeug nach Island ausgeflogen (!) wurde, um dort in einer Bucht bei der Insel Heimaey wieder der freien See übergeben zu werden. Inzwischen ist er an Lungenentzündung gestorben.
Dort, wo „Keiko“ mal als Filmschauspieler eingesperrt gelebt hat, tummeln sich heute Seelöwen, als wäre es die natürlichste Sache der Welt, um hier inmitten all des Trubels und der Touries, ihr Mittagsschläfchen zu halten oder rumzugrölen. Ja, so hört sich ihr Brüllen wirklich an.
 Die fühlen sich hier „sauwohl“.
Die fühlen sich hier „sauwohl“. 
Da ich heute noch nicht einmal gefrühstückt hatte und – man glaubt es kaum – auf der ganzen Reise noch keinen Lachs gegessen hatte, meldete sich mein Magen durch leichtes Knurren (was ich wohl beim Brüllen der Seelöwen überhört hatte). Ich suchte also nach einem Restaurant, das Lachs auf der Karte hatte, und so schlenderte ich die Hafenstraße entlang immer weiter östlich.Die meisten Restaurants hatte ich schon passiert, da sah ich auf der anderen Seite ein Lokal, das ziemlich voll aussah (schon mal ein gutes Zeichen, wie der erfahrene Restaurantbesucher ja weiß). Und siehe da, es hatte Lachs auf der Karte. Da ich alleine war, brauchte ich keinen Tisch, sondern konnte an der Theke Platz nehmen, direkt vor der offenen Küche.
 Da kochten die Jungs, direkt vor meiner Nase. Vorne rechts ist der „Executive Chef“!
Da kochten die Jungs, direkt vor meiner Nase. Vorne rechts ist der „Executive Chef“!
Ich bestellte mir den Lachs auf der Karte, der mit allerlei Sachen angeboten war unter denen ich mir nichts vorstellen konnte und sagte der Kellnerin bei der Bestellung: „Just plain without anything else, just with pepper and salt“ und als sie nachfragte sagte ich „medium rare“, denn ich habe leider so meine negativen Erfahrungen mit durchgebratenem Fisch sammeln müssen!
Inzwischen hatten zwei Damen neben mir Platz genommen und als diese vor mir ihr Essen bekamen, fragte mich die eine, was ich denn geordert hätte, da ich ja früher bestellt hatte. „Salmon“ antwortete ich, „but they may still catch him“.
Doch dann bekam auch ich mein Essen und es sah sehr gut aus – obgleich anders als „just plain“ bestellt, doch was macht das schon.
 Sieht doch gut aus, oder? Und schmeckte sehr gut. Wohl das beste Essen, das ich auf meiner Tour hatte, auch wenn mein Geburtstagsessen nicht schlecht war.
Sieht doch gut aus, oder? Und schmeckte sehr gut. Wohl das beste Essen, das ich auf meiner Tour hatte, auch wenn mein Geburtstagsessen nicht schlecht war.
Wie Frauen nun mal so sind – wohl besonders in Amerika – sind sie ja alle sehr neugierig und so fragte mich die Nachbarin so dies und das und somit kam denn auch ein Gespräch auf, das dann noch sehr nett wurde. Ich sagte woher ich kam und was ich hier machen würde und das fanden die Beiden sehr interessant, offenbar so interessant, dass ich ihnen sogar meine Visitenkarte gab. Die eine Dame hat nämlich eine Freundin, die Deutsch könne und somit in der Lage wäre, meine vielen Reisen im Internet nachzulesen. Zum Schluss hieß es dann: „It was nice to meeting you“ (das werde ich nie lernen, warum es „to meeting you“ und nicht „to meet you“ heißt) und ich machte noch ein Foto von den beiden Damen, damit sie sich in 3 – 4 Wochen im Internet sehen können, wenn ich meinen Bericht fertig habe. Und das sind sie:
 Martha und Emma…
Martha und Emma…  … im „Local Ocean Seefood” Restaurant
… im „Local Ocean Seefood” Restaurant
Weiter ging´s entlang der Küste über einige sehr schöne Brücken,  während im Osten immer noch dicke Wolken hingen (und die „Oregan Beavers“ nass werden ließen…).
während im Osten immer noch dicke Wolken hingen (und die „Oregan Beavers“ nass werden ließen…).
Und dann sah ich wieder diese unwahrscheinlichen Bilder an der Küste:
 Besonders imposant: „The Ocean Geysir” am Spouting Horn
Besonders imposant: „The Ocean Geysir” am Spouting Horn 




Und dann tauchten sie hinter Dunes City plötzlich auf: die riesigen Oregon Dünen.
 Zunächst noch als langer Strand mit nicht allzu hohen Dünen, doch dann wurden die Dünen bei Winchester Bay so richtig groß.
Zunächst noch als langer Strand mit nicht allzu hohen Dünen, doch dann wurden die Dünen bei Winchester Bay so richtig groß. 
 Ein Paradies für Quads.
Ein Paradies für Quads.  Es müssen wohl Hunderte, wenn nicht Tausende Quads-Enthusiasten gewesen sein, die sich hier – und nicht nur hier, sondern an der ganzen weiteren Küste – tummelten. Als Deutscher ist man zunächst entsetzt und denkt an „Dünenschutz! Dünenschutz! Dünenschutz!“, doch hier ist das offenbar kein Thema. Es ist sogar eine offizielle „Recreation Area“ des Staates Oregon!
Es müssen wohl Hunderte, wenn nicht Tausende Quads-Enthusiasten gewesen sein, die sich hier – und nicht nur hier, sondern an der ganzen weiteren Küste – tummelten. Als Deutscher ist man zunächst entsetzt und denkt an „Dünenschutz! Dünenschutz! Dünenschutz!“, doch hier ist das offenbar kein Thema. Es ist sogar eine offizielle „Recreation Area“ des Staates Oregon!
Auf diesen herrlichen Dünen tummeln sich die Quads, mit Verkehrsschildern für andere (wie mich) 
 Hier fährt einer gerade wieder los (mit St. Pauli-Fahne! Ob er das wohl weiß?)
Hier fährt einer gerade wieder los (mit St. Pauli-Fahne! Ob er das wohl weiß?)
Ob es nur an dem verlängerten Wochenende lag – Montag ist „Labour-Day“ und somit Feiertag – oder ob es hier immer so voll ist. Hier in den USA nennt man sie OHV – was ja eigentlich Overhead valves d. h. oben liegende Ventile heißt, wie ich im Internet recherchieren konnte. Diese Motoren werden vielfach in Rasenmähern eingebaut und wohl auch in Quads.
Es muss unzählige Anhänger davon geben. Wenn man bedenkt, was das alles kostet, denn alle hatten entweder einen riesigen Wohnwagen mit Anhänger oder einen ebenfalls riesigen Klein-LKW (natürlich Vierradantrieb) mit noch größerem geschlossenen Anhänger, in dem die OHV`s transportiert wurden. Das muss doch alles zusammen mindestens 100.000 $ gekostet haben!
Nun, hier werde ich wohl keine Bleibe finden – obgleich die meisten wohl im Wohnwagen oder Zelt übernachten – doch nicht weit davon entfernt, kurz vor North Bend im Angesicht dieser schönen Brücke, habe ich doch ein kleines Motel gefunden.
Selbst Abend um 9 Uhr höre ich immer noch das Geknatter der Quads – und das keineswegs, weil es noch von heute Nachmittag in meinen Ohren klingt – sondern sie sind immer noch unterwegs sind, denn auch auf diesen Dünen ist so ein „Oregon Dunes Recration Center“. Man glaubt es kaum!
Übernachtet habe ich in dem kleinen „Bay Bridge Motel“  direkt neben der Brücke, doch einen Blick auf den Fluss hatte ich nur durch das Badezimmerfenster mit Fliegengitter davor. Wer hat das Ding nur so gebaut, dass man den Hauptblick zur Straße hat und zur Schokoladenseite nur aus dem Bad mit Fliegengitter schauen kann?
direkt neben der Brücke, doch einen Blick auf den Fluss hatte ich nur durch das Badezimmerfenster mit Fliegengitter davor. Wer hat das Ding nur so gebaut, dass man den Hauptblick zur Straße hat und zur Schokoladenseite nur aus dem Bad mit Fliegengitter schauen kann?
 Den Sonnenuntergang musste ich also neben dem Motel aufnehmen und den
Den Sonnenuntergang musste ich also neben dem Motel aufnehmen und den  Vollmond mit dem Jupiter schräg darunter habe ich dann auch noch im Bild festgehalten.
Vollmond mit dem Jupiter schräg darunter habe ich dann auch noch im Bild festgehalten.
So, nun ist es inzwischen schon wieder nach 9 Uhr abends. Ich habe – da ich heute Mittag gut gegessen hatte – mir nur ein bisschen Stilton Käse gekauft und dazu Crackers und Rotwein verzehrt. Das habe ich noch nicht einmal gänzlich aufgegessen…
Sonntag, der 6. September 2009
Der erste Blick gilt morgens wie immer dem Wetter: bewölkt doch nicht regnerisch. Das sollte sich ändern, aber in den ersten Stunden wusste das Wetter noch nicht so richtig, was es wollte.
 Mal teils blauer Himmel mit weißen Wolken, dann etwas bedeckter und dann auch mal ein Regenschauer, sogar mit Regenbogen. Doch wenn mich meine Deutung der Wettervorhersage nicht getäuscht hat, muss es im Süden besser und wärmer werden.
Mal teils blauer Himmel mit weißen Wolken, dann etwas bedeckter und dann auch mal ein Regenschauer, sogar mit Regenbogen. Doch wenn mich meine Deutung der Wettervorhersage nicht getäuscht hat, muss es im Süden besser und wärmer werden.
Als ich weiter fuhr hörte ich an einem View-Point komische Geräusche: Erst dachte ich, da hätte einer das Radio ein bisschen laut gedreht, dann meinte ich, es wären vielleicht Kindergeschrei, doch dann sah ich dieses Schild und da sah ich sie denn auch schon:
 Da liegen sie (obgleich man sie nicht oder kaum erkennen kann): die röhrenden Seelöwen. Ob auch See-Elefanten dabei waren, kann ich leider nicht sagen, denn so genau konnte man das aus der Entfernung ohne Fernglas nicht erkennen. Da fehlt mir denn doch ein Teleobjektiv.
Da liegen sie (obgleich man sie nicht oder kaum erkennen kann): die röhrenden Seelöwen. Ob auch See-Elefanten dabei waren, kann ich leider nicht sagen, denn so genau konnte man das aus der Entfernung ohne Fernglas nicht erkennen. Da fehlt mir denn doch ein Teleobjektiv.
Ich habe nicht gezählt, wie oft ich das Auto verlassen und mir die Küste angeschaut habe oder auch mal an den Strand gegangen bin, doch es muss mindestens 50 mal gewesen sein, so gewaltig schön ist die Küste von Oregon!
Ich muss auch nicht erläutern, welches Bild zu welchem Nationalpark gehört, denn es gibt unzählige und wer kann schon sagen, welcher schöner ist. Ich fand sie alle unwahrscheinlich schön und konnte mich nicht sattsehen! Daher auch jetzt eher Bilder als Kommentare dazu:
Die obigen Bilder sind alle bei Bandon entstanden, ein kleiner netter Ort mit einem historischen Hafenbereich. Das hat mir alles sehr gut gefallen!
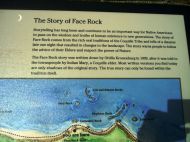 Hier auf einer Karte die verschiedenen Inseln.
Hier auf einer Karte die verschiedenen Inseln.  Viele „Emmas“ habe ich nicht gesehen.
Viele „Emmas“ habe ich nicht gesehen.
. Beim Weiterfahren lief mir dieser Elk über den Weg.
Beim Weiterfahren lief mir dieser Elk über den Weg.  Ist er nicht possierlich?
Ist er nicht possierlich?
Da ich in dem kleinen Motel nichts zum Frühstück bekommen habe, und ein paar Kekse und zwei Pfirsiche auch bald nicht mehr ausreichten, um mein Magenknurren zu besänftigen, bin ich in Port Orford einem guten Marketing-Trick gefolgt: Die 101 machte im Ort einen scharfen Bogen nach links, doch es führt auch eine Straße gerade aus, die etwas ansteigt. Und was hat man da auf die Straße gemalt: „Ocean View“! Auf den Trick bin ich gerne hereingefallen, denn so lernte ich ein kleines rustikales Hafenrestaurant kennen, wo ich meinen Hunger auf angenehme Art und Weise stillen konnte.
 Könnte auch die Hafenbar in einem Schmugglernest sein, oder etwa nicht?!
Könnte auch die Hafenbar in einem Schmugglernest sein, oder etwa nicht?!  My breakfast.
My breakfast.
Gut gestärkt bin ich danach an der Küste weitergefahren, nicht ohne laufend anzuhalten und die vielen View Points zu besuchen. 

Dann kam ich an den „Humbug Mountain“, der nur halb zu sehen war. Er soll mit 580 Metern Höhe der höchste Berg direkt am Pazifik sein. Er hüllt sich in Schweigen, denn er hütet ein Geheimnis, dass selbst der Baedeker nicht herausbekommen hat. Dort steht nämlich drin, dass man nicht weiß, warum man ihn Humbug Berg nennt, doch ich kann es mir sehr gut vorstellen:
Als sich die Straßenbauingenieure Gedanken darüber machten, wie sie die Straße am besten auf der Küstenseite – wie fast überall – bauen sollten, ist einer bestimmt auf die Idee gekommen und sagte: Lasst doch den Humbug (= Unsinn): wir bauen die Straße auf der Landseite durch das Flussbett, das um den Berg herumführt. Klingt doch plausibel, oder? Und so wurde es auch gemacht.
Und dann kam dieser Strand. Von hier oben noch als ziemlich harmlos anzusehen, doch wenn man runter an den Strand ging, sah man das:
Man bekommt die Dimensionen der Wellen auf diesen Bildern gar nicht so rüber, doch es waren mindestens drei Meter hohe Brecher, die da an den – verhältnismäßig steil ansteigenden – Strand anbrandeten. Daher wohl auch die sich hoch aufbäumenden Wellen.
Außer mir war noch ein Ehepaar am Strand. Der Mann musste aufpassen, dass er beim Fotografieren nicht von einer Welle erfasst wurde, denn er ging ziemlich nahe heran; und sie hatte ihren Fiffi gleich auf den Arm genommen, denn den hätten die Wellen glatt erwischt! Er fragte mich so im vorübergehen, warum diese Wellen wohl keine Surfer anlocken würden und ich meinte, die wären wohl zu kräftig und würden sie zerschmettern. Ob´s stimmt? Keine Ahnung.
Bei der Ausarbeitung meiner Reise hatte ich vom „Rogue River“ gelesen, der sehr interessant sein sollte und ich dachte, dass es etwas mit Rough zu tun haben könnte, also ein Wildwasserfluss mit vielen Stromschnellen, auf denen sich die Fahrer mit ihren Jet-Boote so richtig austoben konnten. Doch da muss ich wohl was falsch verstanden haben, denn interessant war der Fluss nur für Lachsangler, die über den Fluss tuckerten und versuchten, ihr Abendbrot zu fischen.
Da einzige was ich interessant fand, war dies:

 Erst dachte ich, dass es vielleicht Weißkopfadler – dem Nationalvogel – wären. Doch so dicht an der Straße und an einem Fluss? Es könnten aber auch Pelegrine Falken gewesen sein, wie ich später auf einem anderen Hinweisschild gelesen habe, die so ähnlich aussahen.
Erst dachte ich, dass es vielleicht Weißkopfadler – dem Nationalvogel – wären. Doch so dicht an der Straße und an einem Fluss? Es könnten aber auch Pelegrine Falken gewesen sein, wie ich später auf einem anderen Hinweisschild gelesen habe, die so ähnlich aussahen.
 Und dann wieder diese Küste!
Und dann wieder diese Küste! Mit ihren Felsen im Meer, an den sich die Wellen immer wieder versuchen – und auf Dauer mit Erfolg. Wer ist stärker? Das Wasser oder der der Fels?
Mit ihren Felsen im Meer, an den sich die Wellen immer wieder versuchen – und auf Dauer mit Erfolg. Wer ist stärker? Das Wasser oder der der Fels? 


 Herrliche Küste – ich komme aus dem Staunen und der Bewunderung gar nicht mehr heraus!
Herrliche Küste – ich komme aus dem Staunen und der Bewunderung gar nicht mehr heraus!

 Möchte man hier nicht wohnen oder ein Hotel errichten? Ich schon!
Möchte man hier nicht wohnen oder ein Hotel errichten? Ich schon!
 Doch diesen kleinen Freund wollen wir auch nicht vergessen. Er wohnt hier nämlich schon und hatte überhaupt keine Angst vor mir. Bin doch auch ein ganz Lieber!
Doch diesen kleinen Freund wollen wir auch nicht vergessen. Er wohnt hier nämlich schon und hatte überhaupt keine Angst vor mir. Bin doch auch ein ganz Lieber!
Diese herrlichen Naturschönheiten bestanden zwar schon immer, doch man hat es Samuel H. Boardman zu verdanken, dass sie heute National Parks geworden sind und somit unter Naturschutz stehen. Er gilt somit zu Recht als „Der Vater der Nationalparks von Oregon“. Gratulation!
Und damit verließ ich Oregon und ich muss sagen, ich habe dieses Land schätzen und lieben gelernt.
„Good by Oregon and I hope to see you again!”
An der „Grenze“ nach Kalifornien wird man tatsächlich kontrolliert, doch wird nicht nach dem Pass gefragt, sondern ob man Obst oder andere landwirtschaftliche Erzeugnisse dabei hat! Gibt´s nur im „Terminator“-Land von Arnold Schwarzenegger…
 Das ist jetzt wieder die Küste von Kalifornien, doch wenn man so viele – wahnsinnig schöne – Küstenstreifen erlebt hat, ist man praktisch überfüttert und froh, mal was anderes als Küsten zu sehen und das gibt es hier.
Das ist jetzt wieder die Küste von Kalifornien, doch wenn man so viele – wahnsinnig schöne – Küstenstreifen erlebt hat, ist man praktisch überfüttert und froh, mal was anderes als Küsten zu sehen und das gibt es hier.
Bitte beachten: Die nachfolgenden Bilder sind ausschließlich im Hochformat, denn schon in diesem Format bekommt man immer höchstens die Hälfte aufs Bild:
„Big Tree“  Und die Maße dieser „Dame“: Größe: 304 Fuß = 93 Meter, Dicke: 21,6 Fuß = 6,58 m, Bauchumfang 68 Fuß = 20,73 m. Nun, wenn man das Alter der Dame gedenkt: 1.500 Jahre (!), dann sollte man als Kavalier schon man mal ein Auge zudrücken. Nicht wahr? Oder ist es ein Er!? Dann ist es ein stattliches Mannsbild!
Und die Maße dieser „Dame“: Größe: 304 Fuß = 93 Meter, Dicke: 21,6 Fuß = 6,58 m, Bauchumfang 68 Fuß = 20,73 m. Nun, wenn man das Alter der Dame gedenkt: 1.500 Jahre (!), dann sollte man als Kavalier schon man mal ein Auge zudrücken. Nicht wahr? Oder ist es ein Er!? Dann ist es ein stattliches Mannsbild!
Das waren nun die zweiten „Redwooods“ auf meiner diesjährigen Reise und ich weiß nicht, ob die Redwoods hier oder im „Humboldt Redwoods Nationalpark“ größer sind – ich glaube ja – doch was spielt das letztendlich für eine Rolle? Die Redwood- oder Sequoia-Bäume sind schon die gewaltigsten Bäume der Welt, die nur noch in Neuseeland – wo ich ja auch schon war – ähnliche Ausmaße erreichen können (hoffentlich liege ich da – als nichtanerkannter Wissenschaftler – nicht falsch).
Doch wozu hat man Internet: Der Kauri-Baum auf Neuseeland wird nur bis zu 50 m hoch, hat nur 1 – 4 Meter Durchmesser und einen Stammumfang von bis zu 16 Metern. Also weniger als halb so groß. Dafür wird er aber bis zu 4.000 Jahre alt.
Auf der Weiterfahrt wunderte ich mich plötzlich, warum so viele Autos am Straßenrand standen. Und dann sah ich den Grund dafür:
 Freilaufende Hirsche am Wegesrand asen friedlich vor sich hin und lassen sich auch durch Autos nicht stören.
Freilaufende Hirsche am Wegesrand asen friedlich vor sich hin und lassen sich auch durch Autos nicht stören.

 Noch zwei letzte Bilder von einer im Abendlicht sich zeigenden Küste, denn langsam werde auch ich müde und muss mir eine Bleibe suchen.
Noch zwei letzte Bilder von einer im Abendlicht sich zeigenden Küste, denn langsam werde auch ich müde und muss mir eine Bleibe suchen.
Habe ich auch gefunden: kurz vor Trinidad, doch nicht in der Karibik, sondern in California! Auch diesmal kein Internetzugang im „Patriks Point Inn“.  Schon das dritte Hotel hintereinander. So langsam weiß ich nicht mehr, was in der Welt und zuhause los ist?
Schon das dritte Hotel hintereinander. So langsam weiß ich nicht mehr, was in der Welt und zuhause los ist?
Da ich auch heute Mittag schon eine warme Mahlzeit hinter mir hatte, habe ich mir wieder einen Käse – diesmal Camembert – und eine Flasche Rotwein gekauft und das war meine Abendmahlzeit. Man lebt nicht schlecht in Kalifornien.
Und nun ist es schon wieder viertel vor 10 und ich werde mich mal bettfein machen.
Montag, der 7. September 2009
So, heute ist nun mein letzter voller Reisetag, denn morgen muss ich ja schon gegen Mittag am Flughafen sein, so dass ich mich für heute Abend irgendwo ca. 2 Stunden vor San Franzisco einquartieren werde, denn ich vermute, dass die Straßen heute Abend sehr voll sein werden, da alle aus dem verlängerten Wochenende – heute ist Labour-Day – zurückfahren wollen.
Das Wetter sieht gut aus, so dass ich mir auch die Altstadt von Eureka und wohl auch von Ferndale ansehen kann, die ich an den ersten Tagen – wegen Nebel – habe ausfallen lassen müssen.
Dann scheint mir die Idee nicht schlecht zu sein, noch einmal meinen General Store in Tomales zu besuchen, um mit Frau Larsen über unsere Vorfahren zu plaudern und meine Familie mit Diekmann`s Caps auszustatten.
Während ich diese Zeilen schreibe, ist es schon wieder Abend. Obgleich ich es bis nach Tomales nicht ganz geschafft habe – das werde ich wohl morgen früh erledigen müssen – bin ich heute ziemlich viel gefahren und das hat mich doch etwas geschlaucht. Über 11 Stunden unterwegs ist doch `ne ganze Menge. Jedoch wollte ich lieber heute etwas mehr fahren, um Morgen nicht unter Druck zu stehen, denn und wer weiß, welchen Verkehrsstau ich auf dem Weg nach und durch San Franzisco zu erwarten habe.
Der Tag fing wunderbar an. Der Himmel blau, nur über dem Meer noch ein zarter Schleier: 
 Nun gut, Madam die Meerschaumgeborene, hat kurz vor 8:00 Uhr am Feiertag Morgen (heute ist ja Labour Day) noch nicht ganz ausgeschlafen. Sie sieht aber schon sehr gut aus!
Nun gut, Madam die Meerschaumgeborene, hat kurz vor 8:00 Uhr am Feiertag Morgen (heute ist ja Labour Day) noch nicht ganz ausgeschlafen. Sie sieht aber schon sehr gut aus!
Kurze Zwischenfrage: Warum heißt es eigentlich „der“ Pazifik und „der“ Atlantik? Nord- und Ostsee heißen doch auch „die“? Nur weil Pazifik und Atlantik größer und stärker sind? Macho-Sprachgebrauch, kann ich da nur sagen. Hat mit Gleichberechtigung nun wirklich nichts mehr zu tun. Muss dies doch mal der „Frauenbeauftragten“ stecken, dass das nicht in Ordnung sein kann…
Heute hatte ich beschlossen, nicht hungrig loszufahren, sondern ein gutes Frühstück zu mir zu nehmen. Das habe ich dann auch getan und zwar in dem reizenden Ort Trinidad (wie schon erwähnt nicht in der Karibik) und zwar hier:

 Zauberhafter Blick vom alten Leuchtturm in Trinidad und gleich daneben dieses nette Lokal
Zauberhafter Blick vom alten Leuchtturm in Trinidad und gleich daneben dieses nette Lokal  „Eatery & Gallery“.
„Eatery & Gallery“.
 Als ich mich Eureka näherte, sah ich schon die Nebelschwaden. „Nicht schon wieder“ dachte ich.
Als ich mich Eureka näherte, sah ich schon die Nebelschwaden. „Nicht schon wieder“ dachte ich.



 Doch ich hatte Glück. In Eureka war wunderbarer Sonnenschein, sodass ich mir im Vorbeifahren einige alte Häuser ansehen konnte. Sehr schön anzusehen, doch mehr war für mich nicht drin. Sorry!
Doch ich hatte Glück. In Eureka war wunderbarer Sonnenschein, sodass ich mir im Vorbeifahren einige alte Häuser ansehen konnte. Sehr schön anzusehen, doch mehr war für mich nicht drin. Sorry!
Eigentlich gibt es hinter Eureka einen Abzweig an der Küste entlang, doch ich weiß nicht, ob ich die richtige Straße gefunden habe.
 Gesehen habe ich nur diese mächtige Zeder (ist doch eine, oder?).
Gesehen habe ich nur diese mächtige Zeder (ist doch eine, oder?).
Also kehrte ich um und fuhr den Weg über den Highway 101 bis das Hinweisschild nach Ferndale kam. Dort wollte ich ja schon auf der Hinfahrt gewesen sein – Sie erinnern sich vielleicht – doch der Nebel hatte vorige Woche meinen Plan geändert.
 Über diesen Fluss muss man fahren (man kann nicht anhalten, daher die Stange im unteren Bild), um in die viktorianische Stadt Ferndale zu kommen.
Über diesen Fluss muss man fahren (man kann nicht anhalten, daher die Stange im unteren Bild), um in die viktorianische Stadt Ferndale zu kommen.



 Sehr schön anzusehen
Sehr schön anzusehen 

 – wenngleich vieles nur Fassade – wenn man mal von der Seite schaut.
– wenngleich vieles nur Fassade – wenn man mal von der Seite schaut. 

Schön sind auch einige Details:
 Hat man hier früher die Pferde festgemacht?
Hat man hier früher die Pferde festgemacht?  Weinflaschenhalter in den vielfältigsten Formen!
Weinflaschenhalter in den vielfältigsten Formen!
Auf der Weiterfahrt habe ich mir gedacht, ich sollte dem Bürgermeister mal einen Brief schreiben und mich als Marketing-Chef empfehlen. Was machte die Stadt aus ihrer viktorianischen Fassade? Nichts – oder war ich morgens um 10:00 Uhr zu früh, denn der Ort war fast leer – oder viel zu wenig los. Da dachte ich an Leavenworth, der bayerischen Stadt im Staate Washington, oder an Williamsburg an der Ostküste, wo die Menschen in alten Trachten und Uniformen rumlaufen sollen (als ich vor über 20 Jahren da war, habe ich allerdings keine Verkleidungen gesehen), wo man es verstanden hat, aus der Geschichte etwas für den Tourismus von heute zu machen.
Warum könnte sich Ferndale nicht als „The Romance Capitol oft the World“ verkaufen? (Vergessen Sie Rothenburg, die es marketingmäßig auch nicht geschafft hat, sich als „Romantik Hauptstadt der Welt“ zu „verkaufen“, obgleich sie eine Berechtigung hätte!)
Alle Menschen Ferndales müssten in viktorianischer Tracht herumlaufen, die Hotels würden in Zusammenarbeit mit den vielen Kirchen, die ich gesehen habe, Hochzeiten ohne Ende verkaufen. Romantic-Weekends und Hochzeitstage-Arrangements müssten her, die Pfarrer oder Priester würden nicht nur Seelen für sich gewinnen, sondern auch noch bare Münze für das Säckelchen bekommen, und die Souvenirläden wären voll mit Sweet & Love Artikeln. Hochzeitskutschen und Brautkleiderläden würden sich an 365 Tagen die Kunden teilen und der Bürgermeister würde mit jedem Brautpaar einen Baum pflanzen (der natürlich jährlich begutachtet werden müsste, und somit „Repeters“ bringen würde, d. h. die Hochzeitspaare müssen jedes Jahr wiederkommen). Grüne, blaue, Veilchen-, Silberne, Goldene, Diamant- und was es sonst noch für Hochzeiten gibt (ich kenn mich da nicht so genau aus) würden natürlich besonders hervorgehoben werden. Ähnlich wie es die Blumenläden inzwischen machen, zu allen möglichen Anlässen – nicht nur zum Valentins- und Muttertag – Blumen verschenken zu lassen.
Ja, ich glaube, ich würde ein guter Marketing-Manager für Ferndale sein können. Vielleicht schreiben Sie ihm – dem Bürgermeister meine ich – mal einen Brief, denn wenn ich von Ihnen empfohlen werde, und nicht nur von einem Leser, sondern vielen, ist das natürlich viel wertvoller, als wenn ich mich bewerbe. Wer kennt mich denn schon in Ferndale? Niemand!
Im Baedeker steht, dass die Küste südlich von Eureka touristisch nicht erschlossen worden ist – weil der Pacific Coast Highway 1 von den Straßenbauingenieuren nicht an der Küste weiter gebaut wurde, sondern wie beim Humbug Berg aus topographischen Gründen ins Landesinnere verlegt werden musste – entschloss ich mich, über die „Lost Coast“ zu fahren. Dazu muss man bereit sein folgendes in Kauf zu nehmen:
– Sehr kurvenreiche Straßen,
– sehr schlechte Straßen (rough roads ohne Ende!),
– teilweise sehr steile Straßen,
– teilweise sehr schlecht einzusehende Straßen (bei Sonnenschein ist durch den Lichteinfall in den Wäldern zwischen Hell und Dunkel manchmal nicht zu erkennen, wohin der Weg führt, man kommt aus dem Hellen und im schattigen Teil biegt die Straße plötzlich nach links oder rechts ab), und
– man muss viel Zeit mitnehmen.
Ich habe für diese Strecke über zwei Stunden gebraucht, obgleich ich nur hin und wieder angehalten bin, um ein Bild zu schießen. Denn das lohnt auf jeden Fall! Sehen Sie selbst:
 „Golden Hills“, auf denen auch mal eine Kuh grast
„Golden Hills“, auf denen auch mal eine Kuh grast 
 und dahinten ist das Meer (mit Nebel?)
und dahinten ist das Meer (mit Nebel?)

 Nein, heute mals kein Nebel, sondern nur hohe Wellen, die sich an den Klippen brechen.
Nein, heute mals kein Nebel, sondern nur hohe Wellen, die sich an den Klippen brechen.
Doch auch weiter im Landesinnern waren interessante Dinge und Landschaften zu bewundern.

 Riesige Eukalyptusbäume, wie ich sie noch nie gesehen habe (wenn es denn welche sind?)
Riesige Eukalyptusbäume, wie ich sie noch nie gesehen habe (wenn es denn welche sind?)
 Wunderschöne Landschaften und
Wunderschöne Landschaften und  Flusstäler und alles – fast – ohne Menschen und Orte.
Flusstäler und alles – fast – ohne Menschen und Orte.
 Auch witzige Nüsse habe ich gesehen (nicht gegessen!) und meinen geliebten „Naturhafer“ oder Hafergras oder wie diese Pflanze auch immer heißen mag, habe ich auch wieder gesehen, den ich an der ganzen Westküste Kaliforniens gefunden habe und der einen so goldigen Glanz ergibt.
Auch witzige Nüsse habe ich gesehen (nicht gegessen!) und meinen geliebten „Naturhafer“ oder Hafergras oder wie diese Pflanze auch immer heißen mag, habe ich auch wieder gesehen, den ich an der ganzen Westküste Kaliforniens gefunden habe und der einen so goldigen Glanz ergibt.
Ich fuhr durch schattige, lichtdurchflutete Straßen, bis dann plötzlich diese Riesen wieder erscheinen, die man nur im Hochformat fotografieren kann: Redwoods im Humboldt Nationalpark.



 Die Mammutbäume werden natürlich auch touristisch – nicht ohne Erfolg offenbar – genutzt: Doch warum nicht: Was beliebt ist auch erlaubt. Ein Schelm, der sich Böses dabei denkt! (Ist zwar nicht hierfür gedacht, passt aber trotzdem!)
Die Mammutbäume werden natürlich auch touristisch – nicht ohne Erfolg offenbar – genutzt: Doch warum nicht: Was beliebt ist auch erlaubt. Ein Schelm, der sich Böses dabei denkt! (Ist zwar nicht hierfür gedacht, passt aber trotzdem!)
 Am Rande der Redwoods habe ich noch einen kurzen Besuch im „Benbow Inn“ von 1903 gemacht, ein schönes altes historisches Hotel von 1903, das gut zu den Romantik Hotels gepasst hätte. (Einmal Romantiker, immer Romantiker. Ich kann´s nicht lassen!)
Am Rande der Redwoods habe ich noch einen kurzen Besuch im „Benbow Inn“ von 1903 gemacht, ein schönes altes historisches Hotel von 1903, das gut zu den Romantik Hotels gepasst hätte. (Einmal Romantiker, immer Romantiker. Ich kann´s nicht lassen!) 

Danach habe ich mich wieder über zahllose Kurven – bergauf und bergab – von Legett bis an den Pazifik durchgewunden. Dabei dachte ich immer wieder an meinen Sohn Nils… (Do you remember?)
 Hin und wieder sieht man solche Warnschilder (Anschnallen oder Zahlen!)
Hin und wieder sieht man solche Warnschilder (Anschnallen oder Zahlen!)
Und das ist jetzt wieder am Pacific Coastal Highway 1 „Traumstraße der Welt!“ (heute ohne Nebel)
Was ich jetzt schreibe, mag zwar blöd klingen – ist es wohl auch – doch wenn man die gewaltigen Küsten Oregons und Washingtons in Erinnerung hat, sind die Küsten von Kalifornien etwas zum Ein- oder Abgewöhnen. Nicht negativ gesehen, sondern zur Einstimmung und zum Ausklang: Wunderschön, doch nicht mehr so überwältigend. Finde ich jedenfalls, ohne negative Beigedanken.



 Zwischendurch auch mal wieder etwas, um den Blick nicht für die kleinen Schönheiten am Rande der gewaltigen Kliffs zu verschließen.
Zwischendurch auch mal wieder etwas, um den Blick nicht für die kleinen Schönheiten am Rande der gewaltigen Kliffs zu verschließen.
Und dann kam ich nach Mendocino. An diesen Ort hatte ich nicht so gute Erinnerungen. Nicht etwa wegen des bekannten Songs von Michael Holm, über dessen Text man herrlich schmunzeln kann und über den ich kürzlich eine tolle Persiflage eines Comedians gehört hatte. Nein, es war ein Hotelier, der sich für eine Mitgliedschaft bei den Romantik Hotels Amerika interessiert hatte. Ich fuhr also hin, doch er war bei meiner Ankunft nicht da. Hatte den Termin vergessen oder was auch immer. Ich nahm ein Doppelzimmer – Einzelzimmer gab es nicht – und wartete beim Abendessen auf ihn. Vergeblich. Am nächsten Morgen musste ich für mein Zimmer und Essen für zwei (!) Personen bezahlen mit der Begründung, dass normalerweise ja auch zwei Personen darin geschlafen und im Restaurant gegessen hätten! Ich wiederhole: ZWEI Personen, obgleich ich alleine war. Das Ganze für – wenn ich mich recht erinnere – 200 $ oder mehr! Und das vor über 20 wenn nicht 25 Jahren! So ein Schuft! Diese Abzocke werde ich im Leben nicht mehr vergessen! Verständlich, finden Sie nicht auch? Wollen Sie wissen, welches Hotel? „The Heritage House“.
Doch, Sie werden es nicht glauben, was jetzt rechts neben dem Schild dran stand: „Closed“. Gott straft die kleinen Sünden sofort, die großen später! Abzocken geht nur eine gewisse Zeitlang gut… (das haben die Banken inzwischen auch gemerkt und werden sich – hoffentlich – „kundenfreundlicher“ verhalten!).
 Schauen Sie genau hin: Sehen sie das? Da sitzt doch tatsächlich eine freche Möwe auf dem schneeweißen Haupte – muss wohl Maria sein – und beschei…(sorry) beschmutzt sie! Unerhört und das auf einer Kirche in Mendocino! (Bescheisst hier Jeder Jeden?)
Schauen Sie genau hin: Sehen sie das? Da sitzt doch tatsächlich eine freche Möwe auf dem schneeweißen Haupte – muss wohl Maria sein – und beschei…(sorry) beschmutzt sie! Unerhört und das auf einer Kirche in Mendocino! (Bescheisst hier Jeder Jeden?)
Damit Sie nicht glauben, ich mag Kalifornien nicht mehr, weil ich mich in Oregon verliebt habe, hier noch ein paar Fotos zum Sattsehen. 



 Wat is dat denn nun schon wieder? Wieder einer meiner Läden, von dem ich keine Ahnung hatte?
Wat is dat denn nun schon wieder? Wieder einer meiner Läden, von dem ich keine Ahnung hatte?
Muss wohl doch öfters mal zu zum Kassieren nach California kommen. Geht doch nicht, dass die alle ohne mein Einverständnis meinen Markennamen nutzen. Wo sind wir denn hier? Würde ja genügen, wenn die „Diekmann´s Lizenznehmer“ in Rotwein bezahlen!
Nach langer Fahrt – über 11 Stunden, ich erwähnte es bereits -, kam ich in Bodega Bay an und wollte nun endlich ein Hotel für meine Nachtruhe finden, ohne noch meilenweit fahren zu müssen, damit ich was in meinen ausgehungerten Bauch bekommen würde. Kurz vorher hatte ich zwei Hotels schon wieder den Rücken gekehrt, weil sie mir entweder zu groß waren oder weil man sich einfach nicht um mich kümmern wollte, obgleich ich mehrmals „Hello“ gerufen hatte, aber die Frau im „Back Office“ mich einfach nicht hören oder sehen wollte oder konnte oder was auch immer.
In Bodegay Bay hielt ich dann im „The Inn at the Tides“ an und wusste schon gleich: Das wird nicht billig sein. 160 $ plus Tax war mir zwar viel zu teuer, doch was tut man sich am letzen Abend denn noch an? Also nahm ich es.
Da auch hier das Internet nicht funktionierte – bin ich denn blöd oder das System? – Seit vier Tagen bin ich jetzt ohne Verbindung zur Außenwelt! Wer weiß, was alles so passiert ist? Die hören und sehen nichts mehr von mir und ich nichts von Ihnen. Laufen meine beiden Hotels noch und lebt unsere Kanzlerin „Angie“ noch? Sie glauben gar nicht, wie abhängig ich inzwischen vom Internet geworden bin. Nicht etwa vom Wein, wie manche Leser schon vermuten könnten… In diesem Hotel stand sogar eine Flasche Weißwein „complimentary“ im Zimmer zur Verfügung! (Aha, daher der Preis!)
 Da hätten auch 4 Personen gemütlich schlafen können.
Da hätten auch 4 Personen gemütlich schlafen können.
Ganz gut gegessen habe ich auch am letzen Abend – obgleich nicht überwältigend – im „The Tides Warf“, was offenbar zum Hotelkomplex dazu gehört, da ich dort Morgen früh auch mein Frühstück einzunehmen habe.
Als Vorspeise wollte ich in dieser Austerngegend natürlich Austern essen.  Sie waren zwar recht klein (auf dem Foto sieht man nur noch die leeren Schalen, denn mein Hunger ließ mich das Fotografieren vergessen), doch die
Sie waren zwar recht klein (auf dem Foto sieht man nur noch die leeren Schalen, denn mein Hunger ließ mich das Fotografieren vergessen), doch die  Scallops habe ich nicht ganz geschafft. Mein Magen wird halt in diesem Alter etwas schrumpelig und kann nicht mehr so viel verkraften!
Scallops habe ich nicht ganz geschafft. Mein Magen wird halt in diesem Alter etwas schrumpelig und kann nicht mehr so viel verkraften!
Nachdem ich nur die kostenlose Flasche Weißwein „Salmon Creek 2008, California, Chardonnay“ so gut wie ausgetrunken habe, während ich diesen Tagesbericht schreibe, höre ich draußen schon wieder ein Nebelhorn schreien. Muss ich mir da Gedanken machen? Doch nein. Ein Blick nach draußen sagt mir: Klare Nacht, der Mond ist inzwischen auch schon wieder da und es heult wohl an einem andere Ort. Inzwischen ist es Mitternacht und es wird Zeit, die letzten Nachtstunden in den USA im Bett zu verbringen. Sleep well old boy.
Dienstag, der 8. September 2009
Well „ge-sleept“ habe ich überhaupt nicht, denn die ganze Nacht über hörte ich das Nebelhorn jaulen und hatte beim Aufwachen das Gefühl, gar nicht geschlafen zu haben, weil dauernd der Wecker – das Nebelhorn – ging. Am bösen Alptraum gemessen, den ich außerdem hatte, muss ich wohl doch etwas – oberflächlich – geschlafen haben.
Dafür ist die Sonne herrlich aufgegangen und gab einen schönen Blick vom meinem Hotelzimmer mit Balkon über die Bodega Bay frei. Doch das Nebelhorn ist immer noch im Gange.
Eigentlich wollte ich ja noch per Internet meinen Flug einchecken, doch es funktioniert im Zimmer immer noch nicht; vielleicht versuche ich es von der Rezeption aus noch einmal. Jetzt muss ich nur noch alle meine Sachen im großen Koffer verstauen und dann geht es los. Doch vorher will ich noch etwas Frühstücken, dafür habe ich ja einen Gutschein erhalten. Der gilt aber nur für ein Continental breakfast und wer was anderes will, erhält auf das Bestellte 15 % Discount. Sensationeller Rabatt! Richtig zum Totlachen, finde ich.
 Das Tollste am Frühstück war die Aussicht auf die Bay, weil dort die Pelikane ab und zu senkrecht ins Wasser schossen, um sich einen Fisch zu schnappen. Leider konnte ich so schnell gar nicht fotografieren, sondern erwischte sie erst, nachdem sie schon ins Wasser gezischt und erst als sie wieder aufgetaucht waren. Manchmal hatte ein Pelikan einen Fisch im Schnabel, manchmal aber auch nicht. Dann saß er noch ein paar Sekunden und sagte sich bestimmt: „Pech gehabt. Daneben. Doch beim nächsten Mal erwische ich dich schon!“ Dann setzt er sich wieder schwerfällig mit vielen Paddelschlägen in die Lüfte und segelte weiter.
Das Tollste am Frühstück war die Aussicht auf die Bay, weil dort die Pelikane ab und zu senkrecht ins Wasser schossen, um sich einen Fisch zu schnappen. Leider konnte ich so schnell gar nicht fotografieren, sondern erwischte sie erst, nachdem sie schon ins Wasser gezischt und erst als sie wieder aufgetaucht waren. Manchmal hatte ein Pelikan einen Fisch im Schnabel, manchmal aber auch nicht. Dann saß er noch ein paar Sekunden und sagte sich bestimmt: „Pech gehabt. Daneben. Doch beim nächsten Mal erwische ich dich schon!“ Dann setzt er sich wieder schwerfällig mit vielen Paddelschlägen in die Lüfte und segelte weiter.
Da ich ja noch nach Tomales wollte, musste ich mich nun langsam sputen, um in „unserem“ Diekmann´s Gerneral Store „Diekmann´s“ Mützen für die ganze Familie zu kaufen.
 Heute stand kein Lastwagen vor der Tür, der die Sicht versperrte.
Heute stand kein Lastwagen vor der Tür, der die Sicht versperrte.
Leider war Mrs. Swanson nicht anwesend, doch der Ladeninhaber versprach, ihr schöne Grüße zu bestellen. Ich erzählte ihm von dem „Diekmann´s Bay Store“, den ich ein paar Orte vorher gesehen hatte und er erzählte mir, dass dieser Store dem Bruder von dem früheren Ladenbesitzer hier in Tomales war. Ich kaufte alle Diekmann´s Mützen, die ich finden konnte und noch zwei Schlappmützen für Lena und Emilia und verabschiedete mich dann aus „meinem“ General Store.
Bei Marshall bog ich vom Highway 1 ab nach Novato, um schneller zum Airport zu kommen. Dabei hätte ich mich beinahe noch verfranzt, es jedoch noch rechtzeitig gemerkt.
Auf dieser wenig befahrenen Strecke lernte ich wieder eine neue Landschaft kennen und wurde hin und wieder an die Zeit von vor 200 Jahren und später an die vor ca. 60 -70 Jahren erinnert:
 Über solche Pfade sind wohl die ersten Siedler vor 200 Jahren gen Westen gezogen…
Über solche Pfade sind wohl die ersten Siedler vor 200 Jahren gen Westen gezogen…
 …und mit diesen Lastwägen wohl in den 20er und 30er Jahren herumkutschiert.
…und mit diesen Lastwägen wohl in den 20er und 30er Jahren herumkutschiert.

 Diese beiden Modelle sehen ja schon richtig modern aus! Wollen die daraus ein Museum machen?
Diese beiden Modelle sehen ja schon richtig modern aus! Wollen die daraus ein Museum machen?
Heute hatte ich Glück in San Franzisco, doch wenn ich früher am Tag angekommen wäre, hätte ich vielleicht das Gleiche erleben können, wie am 2. Tag:
 Die Golden Gate Brücke mit Nebelresten, doch deutlich zu erkennen!
Die Golden Gate Brücke mit Nebelresten, doch deutlich zu erkennen! 
Da ich gut in der Zeit war, machte ich noch einen U-Turn hinter der Brücke und fuhr direkt an die Bucht von San Franzisco. Da konnte man die Brücke denn auch in Ruhe fotografieren und nicht nur vom fahrenden Autos aus.  Der Stolz San Franziscos…
Der Stolz San Franziscos…  …und sein berühmtestes Gefängnis: Al Catraz
…und sein berühmtestes Gefängnis: Al Catraz
Auch diese kleinen Vögel fand ich sehr reizvoll und sie waren so zutraulich, so dass ich sie endlich fotografieren konnte, was mir unterwegs nie gelang, denn da flogen sie sofort weg, sobald sie mich nur sahen!
 Zum Dank durften sie denn auch meinen nicht gegessenen Frühstückstoast von gestern zu sich nehmen.
Zum Dank durften sie denn auch meinen nicht gegessenen Frühstückstoast von gestern zu sich nehmen.
Dann konnte ich mir auch noch die Cable-Cars ansehen und noch einige Gebäude von SF aufnehmen, bevor ich dann die Stadt verlies und mich aufmachte, mein Mietauto abzuliefern.

 Sie gehören zu San Franzisco, wie der Dom zu Köln: Die Cable Cars
Sie gehören zu San Franzisco, wie der Dom zu Köln: Die Cable Cars
 Die berühmten „ Straßen von San Franzisco“: so steil, dass man bei manchen nicht einmal die nächste Querstraße erkennen kann. Bekannt aus zahlreichen Filmen.
Die berühmten „ Straßen von San Franzisco“: so steil, dass man bei manchen nicht einmal die nächste Querstraße erkennen kann. Bekannt aus zahlreichen Filmen.
 Die City Hall
Die City Hall  Noch ein letzter Blick auf die Skyline von S.F.
Noch ein letzter Blick auf die Skyline von S.F.
Obgleich ich in meinem Zeitplan war, wurde ich auf dem Weg zum Flughafen doch ein wenig nervös. Nachdem mir die Dame an der Tankstelle – man muss ja seinen Wagen vollgetankt zurückgeben – gesagt hatte, ich müsste nur weiter gen Süden fahren, habe ich mich doch noch ein paar Mal verfahren und das ging ganz schön an meine Nerven!
Die Beschilderung zum Rental-Car-Return ist – nach meiner Ansicht – verwirrend, denn man wird zwar auf die richtige Spur zur Autobahnausfahrt geführt, doch dann verließen sie ihn: es gibt keine weiteren Hinweise zur Mietwagenstation, jedenfalls habe ich keine gesehen und bin weiter in Richtung San Bruno gefahren, bis ich merkte, dass ich so nicht zum Airport komme. Da habe ich mich dann an „Airport Parking“ orientiert und auch an ein Eisenbahnsymbol, denn die Mietwagenstationen liegen ja an dem Bahn-Shuttle. Doch das war der falsche Weg!
So landete ich plötzlich irgendwo in einem Wohngebiet. Also wieder zurück zur Camino Real, die ich ja schon von der Ankunft her kannte. Dort habe ich dann in einer Werkstatt nachgefragt. Ja, man muss die San Antonio Ave. fahren, doch nicht bei „Airport Parking“ abbiegen, sondern weiter geradeaus unter den Freeway hindurch fahren, dann würde man die Hinweisschilder auch schon sehen. Und so war es denn auch, doch das hat mich mindestens eine ¼ Stunde gekostet.
Auch mit den Terminals kann man verwirrt werden, wenn man in den automatischen Zügen sitzt, denn nirgendwo wird angezeigt, welche Airline von welchem Terminal aus fliegt. Auch auf meinem Ticket war das nicht vermerkt. So bin ich natürlich viel zu weit gefahren und erst am letzten Terminal ausgestiegen. Da fragte ich eine Dame, die auf einen Zug wartete, ob sie wüsste, von welchem Terminal aus die KLM fliegen würde. Vom International Terminal, sagte sie mir. An dieser Station war ich nicht ausgestiegen, weil dort zwar einige Airlines per Lautsprecher im Zug genannt worden waren, doch nicht die KLM, also war ich weitergefahren.
So, also jetzt 3 Stationen zurück. Das System ist auch verbesserungswürdig, würde ich mal behaupten, denn wenn man unter Zeitdruck wäre, würde das ganz schönen Stress auslösen. Mich hat es auch ganz schön nervös gemacht und von „entspannter Gelassenheit eines Vielreisenden“ konnte nun wirklich nicht mehr die Rede sein. Ich wurde innerlich so kribbelig und es ließ überhaupt nicht mehr nach, sodass ich sogar noch im Flugzeug kaum mein Essen ohne zitternde Hände verzehren konnte. (Das mit dem Zittern wird immer schlimmer und ich muss mich wohl erneut mal untersuchen lassen, woran das liegt. Der Hirnklempner hat letztes Jahr nichts finden können.)
- Tag: Mittwoch, der 9. September 2009
Ja, und nun bin ich in Amsterdam mit dem Jumbo gelandet und es ist 11:00 Uhr – für mich jedoch 2:00 Uhr nachts.
Schlimm sind diese Nachtflüge schon. Unser Flieger war bis auf den letzten Platz ausgebucht und wenn man dann noch in der letzten Reihe mit dem Rücken zur Wand sitzt, wo man die Rückenlehne nicht verändern kann, und dann noch in der Mitte des Mittelblocks, dann denkt man an den Tierschutz. Ja, richtig gelesen: Tierschutz.
Da wird – zu Recht – eine Mindestgröße für die Käfighaltung von Hühnern gefordert und das ist ja inzwischen auch schon Gesetz geworden, doch warum gibt es keine Mindestgröße für einen Sitzplatz für Flugpassagiere? Zumindest auf Strecken, die länger als 1 oder 2 Flugstunden dauern? Wenn es eine Sitzbreite von 60 cm waren und meine Knie fast an den Vordersitz reichen – und ich bin mit 169 cm nun wirklich kein Riese – man also nicht einmal einen halben Quadratmeter Platz zwischen zwei benachbarten Sitzen hat, dann fragt man sich, wie die etwas beleibteren und größeren Menschen diese Käfighaltung aushalten?
Jetzt muss ich hier am Flughafen noch bis 16:00 Uhr warten, bis mein Flieger mich nach Hamburg bringt und wenn ich dann mein Gepäck bekommen habe, zum Parkplatz „geshuttelt“ worden bin und dann beim nach Rendsburgfahren nicht noch unterwegs ein Nickerchen machen muss, werde ich wohl gegen halb acht heute Abend zu Hause sein.
Wenn ich schon jetzt ein kurzes Fazit meiner Reise ziehe, dann sieht es so aus:
- Es war eine wunderbare Reise! Ich kann allerdings nicht sagen, was schöner war: die Küsten oder die Berge oder die Canyons? Sie sind alle gewaltig und atemberaubend schön und ich möchte keinen Tag missen oder als langweilig und uninteressant ansehen.
- Es war eine lange Reise: 4.510 Meilen = 7.261 km! Und das in nur 17 Reise-Tagen, d. h. pro Tag ca. 300 Meilen oder 480 km. Das ist keine Erholung, sondern Travelling.
- Sie verlief ziemlich reibungslos, wenn man mal die Reifenpanne und den Ärger mit dem Einwechseln der Euro-Travellerschecks vergisst.
- Es war sehr gut, dass ich die Reise nicht genau vorgeplant habe, sondern flexibel geblieben bin, denn sonst hätte ich den Küstennebel sehr wahrscheinlich über eine Woche „genießen“ dürfen. So konnte ich rechtzeitig umplanen und bin den widrigen Wettern ausgewichen.
- Wer diese Reise nacherleben möchte, sollte sich entweder mehr Zeit nehmen oder aber nicht alles besuchen wollen. Ich bin an einigen Tagen über neun Stunden nur gefahren und mit den kurzen Fotopausen bis zu elf Stunden unterwegs gewesen.
- Es war die richtige Reisezeit, denn der Nordwesten ist zu anderen Jahreszeiten sehr oft regnerisch und dann sieht man nichts – wie im Küstennebel – und die Reise wird uninteressant, weil man wenig sieht und vieles in Wolken ist. Wirklich erleben möchte ich diese Region – insbesondere Oregon – auch mal im Winter, denn dann könnte man zwischen Wüste und Schneelandschaft eine noch größere Vielfalt erleben. Doch auch das Frühjahr muss sehr schön sein.
- Ich bin froh, dass ich täglich alles aufgeschrieben habe, was ich gesehen und erlebt habe, denn schon jetzt würde ich mich an Vieles nicht mehr erinnern können. So schnell vergesse ich und so viel passt gar nicht in mein kleines Hirn.
- Man braucht auf jeden Fall eine gute Karte – auch der Rand MaNally ist manchmal nicht detailliert genug – und einen Reiseführer. Ich hatte zwar mehrere mit, doch der Baedeker hat mir die besten Dienste erwiesen.
- Ich habe keine Tourist-Infobüros genutzt. Vielleicht habe ich dadurch das eine oder andere verpasst. Doch die hätten mich sicherlich zu diesem Museum oder zu jener Sehenswürdigkeit geschickt, die der typische Tourist sucht, sprich Funparks, Museen, Entertainment und Dinge – was weiß ich auch immer -, die mich persönlich weniger interessieren. Als ich einmal in einem solchen Büro nach Preisen für ein Motel fragte, gab man mir eine Broschüre mit Preisen von z. B. 58 bis 158 $ die Nacht. Als ich in einem Motel dann nach dem aktuellen Preis nachfragte, lag der bei 109 $. Was soll man also mit einer solchen Preisliste anfangen? In den Müll werfen, wäre meine Antwort.
- Was die Preise anbelangt, so werden fast immer nur Preise ohne Tax angeboten – es gab auf der Reise wenig Ausnahmen. Diese Praxis finde ich sehr schlecht, sie ist aber so. Man muss derzeit ca. 11 % hinzurechnen. In dem letzten – teuersten – kam dann noch eine „Tourism Assessment“ Gebühr von 3,38 $ hinzu. Das muss wohl eine Art „Kurtaxe“ sein, wie sie – leider – auch in vielen Seebädern und Kurorten in Deutschland verlangt wird. Davon ist vorher jedoch keine Rede, sondern sie wird einfach ohne Kommentar oder Erläuterung mit auf die Rechnung gesetzt. Bleibt ein fahler Nachgeschmack.
- In den Restaurants muss man immer ein Trinkgeld bezahlen. Das ist praktisch der „Service Charge“, d. h. Lohn für die Servicemitarbeiter/innen, denn sie haben keinen Festlohn. Er sollte mindestens 10 % der Rechnungssumme betragen. Einmal habe ich drei „Suggested Gratuity Amounts“ auf der Rechnung gefunden: 15 %, 18 % oder 20 %. Das war für mich auch neu!
Soweit zunächst mein erstes Fazit. Wenn ich wieder meinen Jet-lag überwunden habe, werde ich sicherlich noch das eine oder andere ergänzen. Jetzt erst einmal Schluss für heute, denn vielleicht kann ich bis zum Abflug gegen 4 Uhr noch ein kurzes Mittagsschläfchen halten, um zumindest etwas Schlaf gefunden zu haben.
Zur Info noch eine Umrechnungstabelle sowie die täglich gefahrenen Strecken:
| Umrechnungstabelle | ||||
| Fuß | 0,30479 | 6.000 | 1.829 | Meter |
| Meilen | 1,61 | 4.508 | 7.258 | km |
| Inch | 0,25 | 1.160 | 290 | cm |
| Tag | Tacho | Meilen | km | |
|
27.552 | 8 | 13 | |
| 21.8.09 | 27.560 | 183 | 295 | |
| 22.8.09 | 27.743 | 257 | 414 | |
| 23.8.09 | 28.000 | 391 | 630 | |
| 24.8.09 | 28.391 | 329 | 530 | |
| 25.8.09 | 28.720 | 2 | 3 | |
| 26.8.09 | 28.722 | 198 | 319 | |
| 27.8.09 | 28.920 | 348 | 560 | |
| 28.8.09 | 29.268 | 164 | 264 | |
| 29.8.09 | 29.432 | 221 | 356 | |
| 30.8.09 | 29.653 | 216 | 348 | |
| 31.8.09 | 29.869 | 240 | 386 | |
| 1.9.09 | 30.109 | 181 | 291 | |
| 2.9.09 | 30.290 | 254 | 409 | |
| 3.9.09 | 30.544 | 310 | 499 | |
| 4.9.09 | 30.854 | 222 | 357 | |
| 5.9.09 | 31.076 | 317 | 510 | |
| 6.9.09 | 31.393 | 259 | 417 | |
| 7.9.09 | 31.652 | 312 | 502 | |
| 8.9.09 | 31.964 | 96 | 155 | |
| Gesamt | 32.060 | 4.508 | 7.258 | |
Nachdem ich inzwischen die einzelnen Tage überarbeitet und kleine Korrekturen angebracht habe, will ich jetzt versuchen, diese Reise als Buch herauszubringen. Doch zunächst werrde ich sie auf CD´s brennen, damit ich der Familie, guten Freunden und Bekannten ein Exemplar zum kritischen Lesen geben und somit testen kann, ob meine Art, über eine Reise zu berichten, beim Leser ankommt.
Rendsburg, 5. Oktober 2009
Jens Diekmann
PS: Diese Reise ist auch als Buch erschienen, das Sie bei mir zum Preis von 19,95 € incl. Versandkosten bestellen können.
Per Post an: Jens Diekmann, Am Gerhardshain 2, 24768 Rendsburg
Über Email an: info@jens-diekmann.de